
Fledermausmutter mit Familie an den Wänden des Untergrundflusses.
Foto: © ingo66@web.de

Fledermausmutter mit Familie an den Wänden des
Untergrundflusses.
Foto: © ingo66@web.de

© "Nik"Klaus Polak, Bonn, Germany
|
Erstellt: April 2005
Die Aufenthalte fanden statt: März und April 2005, Mai 2007, Anfang bis Mitte Juli 2008 sowie Mitte Mai bis Anfang Juni 2011. |
Das angenehmste Klima ist Januar bis Mitte Februar und ab Mitte Mai bis Juli, allerdings muss man ab Juli mit der
einsetzenden Regenzeit rechnen. D.h. zunächst Schauer i.d.R. ab frühen
Nachmittag, zum Sonnenuntergang wieder blauer Himmel, ab Ende Juli spätestens
August muss auch mit ganztägigen Regenfällen gerechnet werden. Allerdings
spielte 2008 das Wetter total verrückt, die Trockenzeit fand nicht in dem
gewohnten Umfang statt. Dafür waren im Juli über 10 Tage vollkommen regenfrei.
Die Trockenzeit verschärfte sich 2009 und 2010, so dass sogar die Bäche und
Seen austrockneten und die Regenzeit stark verspätet im September einsetzte.
2011 gab es ab Mitte Mai - ungewöhnlicherweise - täglich einen einstündigen
Schauer, die auch in halbtägigen Regen übergingen. Wie wir später erfuhren
Ausläufer zweier Taifune, die nur 300 km östlich vorbeizogen.
Keiner soll sich also beschweren, wenn statt Sonne Regen und statt Regen Sonne
angetroffen wird. ![]()
Im folgenden Text ist die Strecke in ihrem Zustand bis 2008 beschrieben, 2011 waren davon bis auf einige bucklige Teerstreckenkilometer zu Anfang und eine weniger als 2 km lange Schotterpiste die gesamte Strecke durchgehend betoniert und in ausgezeichnetem Zustand. Die 77 km lange Fahrt von PPC reduziert sich dadurch auf knapp 3 h (ohne Pausen). Ansonsten hat sich an den Wegmarken und den öffentlichen Bussen nichts geändert.
Der Jeepney in PPC dreht nach der Abfahrt zunächst
einmal eine halbe Stunde an dem Terminal einige Ehrenrunden, bevor es dem Fahrer
auffällt, d.h. andere machen ihn heftig gestikulierend darauf aufmerksam, dass er die Radmuttern anzuziehen hat, dann geht es endlich los.
Nein, doch nicht, es muss ja erst noch getankt werden. Konnte man das nicht
vorher machen?
Am
KM 37.5, bei Salvacion, einem von zwei Ausgangspunkten für Ausflüge in die Honda Bay, zweigt eine Sackgasse nach Sabang ab.
Die Straße ist inzwischen über weite Strecken betoniert, jedoch sinkt die durchschnittliche Geschwindigkeit
auf den Schotterabschnitten immer wieder rapide, zumal an jeder zweiten Palme jemand aus-, vor allem aber zusteigt. War
der Jeepney bei der Abfahrt bis auf den letzten Platz gefüllt, so steigt nach
und nach die gleiche Anzahl Menschen hinzu. Die Frage, wie viele Menschen in
einen Jeepney passen, lässt sich leicht beantworten: immer einer mehr.
ACHTUNG: Fährt man auf einem der wenigen Busse als Dachpassagier, so muss man höllisch achten auf Zweige und an mehreren Stellen auf sehr knapp über dem Busdach hängende Stromleitungen. Bei voller Fahrt kann dies im wahrsten Sinne des Wortes DEN KOPF KOSTEN! Also flach hinlegen, wenn irgendeiner ruft: wire oder attention! Besser ist es in Fahrtrichtung zu schauen, denn oft wird nicht gerufen!
Nach kurzer Zeit ist bei Bahile ein erster
Abzweig zur Ulugan Bay erreicht (hier endete 2008 die durchgehende
Betonstraße). Etwa 1.3 km weiter endet er in Macarascas an einem
Mangrovenfluss, der nach gut Hundert Metern ins Meer mündet. In
der Bucht soll Anfang März 2005 ein interessanter Mangroven-Lehrpfad
mit belgischen Entwicklungshilfegeldern errichtet worden sein, zudem wird
kräftig die Werbetrommel (riesiges Plakat inkl. Profil von Hagedorn an der
Kreuzung) für Schnorchelgebiete gerührt. Bei einer Überprüfung 2008 wusste keiner etwas davon, weder hier noch in Buena Vista. Boote stehen auch nicht
bereit und eines der Fischerboote zu aktivieren würde wohl einige Zeit dauern.
Dann käme noch das Problem zu erklären wo man hin will, wenn man selbst nicht
weiß wo es ist. Ja, da gab es mal ein Fischschutzgebiet, aber das Material
(gemeint waren wohl die Schnorchelausrüstungen) wäre schon längst wieder
kaputt. Und irgendwie wäre wohl auch das Schutzgebiet "in der
Renovierung". Aha.
Weiter geht es über eine staubige Schotterpiste. Nachdem ein
kleiner Pass erklommen ist, erhält man einen schönen Blick über die Bucht von
dem Buena Vista Viewdeck (2 Souvenirshops, auch Snackverpflegung) mit Rita Island (im Besitz von Hagedorn) und den
Tres Maria vor dem Buchtausgang im Südchinesischen Meer. Leider halten die öffentlichen Busse hier
nicht an, ich meine am Aussichtspunkt. Direkt ggü. führt ein schmaler Pfad
hinab zu den Buena Vista Wasserfall, der in der Trockenzeit getrost ausgelassen
werden kann. Wenig später wird die Küste bei einem Fischerdorf kurz gestreift.
Auch hier weiß niemand etwas von einem Mangrovenpfad oder Schnorchelgebieten,
man würde uns aber gerne dorthin schippern ... .
So langsam macht es sich bemerkbar, dass man sich von der Zivilisation ein
wenig entfernt hat: Aufschriften wie "Außenposten" und
"Satelliten-Klinik" (z.B. im 4.2 km entfernten Nasuduan) stimmen nachdenklich.
15 min
später wird ein von der UN und dem Entwicklungsministerium der Königlichen
Niederlande gefördertes Projekt (2005) "tribal rice" passiert, das nach
Insiderauskünften kaum Erfolge vorweisen kann. Dafür hat jemand mehr einen
nagelneuen Wagen, den er nun für private Touren nutzen kann. (2008 war nicht
mal mehr das Hinweisschild da.) Wenige Minuten
später arbeitet sich der überladene Wagen über Stock und Stein in eine Ebene
hinunter (seit 2008 ist die Abfahrt plus ca. 3-4 km betoniert, 2011 wie oben
gesagt fast durchgängig), die verblüffend der Trockenen
Halong Bay bei Ninh
Binh in Vietnam, sowie dem Gebiet um Khao Sok in Thailand gleicht. Mit Sicherheit
waren hier die gleichen geologisch hebenden und erodierenden Kräfte im Spiel.
Bald
weist bei Tagabinet ein Schild zu dem Ugong Rock, der einen prima
Aussichtspunkt bietet - und seit 2011 sogar eine 800 m lange Seilrutsche
(Zip-Line). (Siehe Tourbeschreibung hier.)
In Cabayogan gibt es in der Rangerstation ein kleines
ethnographisches Museum. Die
Lion Cave - der Name stammt von einer Tropfsteinformation am Eingang, die
allerdings mehr wie ein Schaf aussieht - ist nicht so berauschend, das Daylight Hole aber
absolut sehenswert. Hervorragend ist aus die Million-Birds-Cave. Allerdings
dauert der gesamte Trip 8-9 Stunden, daher empfiehlt es sich dort zu übernachten.
Ein Guide kostet etwa 1200 P (2008).
Während der Periode der „Drei Königreiche“, wurden kleinwüchsige, dunkelhäutige
Menschen mit negritischen Wurzeln, die in der Provinz Anwei in Süd-China lebten, von den Ham nach Süden verdrängt. Einige ließen sich nieder in Thailand und Malaysia, andere wandten sich weiter südwärts nach Indonesien,
insbesondere Sumatra und Borneo. Eine Gruppe nutzte die damalige Landbrücke zwischen Borneo und Palawan und
ließ sich dort nieder. Sie wurden als Aetas und Negritos bezeichnet, von
denen die heutigen Batak-Stämme abstammen. Bataks,
was soviel bedeutet wie Menschen der Berge, sind die
kleinste ethnolinguistische Gruppe auf Palawan mit einer rein austronesischen
Sprache. Nur noch 1780 Mitgliedern zählend droht ihre Gemeinschaft und Kultur
vollständig auszusterben. Beheimatet sind sie nur noch in den inneren Bergen
nördlich von PPC und in dem Gebiet zwischen dem Babuyan Fluss und dem Dorf
Malcampo. In der erwähnten Rangerstation gibt
es einige Informationen über diese Ethnogruppen.
10 min weiter führt ein ausgeschilderter Pfad zu dem 7 km entfernten Dorf
Kayasan, das von dem Stamm der Tagbanuwa
(auch Tagbanwa) bewohnt wird, die sich mit Bataks gemischt haben. (Kein
Dschungeltrekk! Kaum lohnenswert! Genau so viele Tagbanuwas leben in Sabang!) Die Tagbanuwas leiten ihren Namen ab von taga = von und banuwa =
Dorf. Sie gehören zum südostasiatischen Ethnotyp und zählen noch etwa 13.500
Mitglieder. Ihre Sprachgemeinschaft ist
mit der austronesischen assoziiert und verfügt über eine einzigartige Silbenschrift, die 1999 von der UNESCO zu den "Erinnerungen der Menschheit"
deklariert wurde.

Silben"alphabet" |
 |
Diese Schriftart, deren Zeichen mir vollkommen
fremdartig vorkommen und zu denen ich keinen Vergleich ziehen kann, steht im
Zusammenhang mit einem poetischen Stil (syllabische Schrift), der auf die Anzahl von Silben in einer
Zeile basiert. Sie stammt, wie die früher
weit verbreitete philippinische Schrift Baybayin, von der javanischen
Kawi-Schrift ab und ist wie diese eine Abugida-Schrift, d.h. jedes Zeichen steht
für eine Silbe, die mit einem bestimmten Konsonanten beginnt, und der Vokal
der Silbe wird durch Hinzufügen oder Weglassen (diakritischer Zeichen)
angezeigt. (Quelle der erweiterten Informationen: de.wikipedia.org/wiki/Tagbanuwa-Schrift)
Die Quelle vor Ort aber sagt im Unterschied zur Wikipedia: Die Schrift ist angelehnt an die Pallava Schrift aus
Südindien, abgeleitet vom Brahmi. Sie wurde ihnen von den Bugis aus Makassar in
vorspanischer Zeit etwa im 15. Jahrhundert beigebracht. Die Schrift wird
traditionell auf Bambusstäben in vertikalen Spalten von unten nach oben und von
links nach rechts geschrieben. Die Sprache wird noch von etwa 8.000 Menschen in
Zentral- und Nord-Palawan gesprochen, aber nur noch von wenigen geschrieben. Trotz des
anfänglichen Hinweisschildes zu dem Dorf empfiehlt es sich einen Führer
mitzunehmen, denn später ist Schluss mit Wegweisern.
Auf dem Jeepney ist ein großer Wassertank montiert, von dem eine Leitung herabreicht, die zum Hände- und Gesichtwaschen usw. benutzt wird. Während der Fahrt betätigt der Fahrer das Drehventil, denn nun braucht der Kühler noch einmal eine kräftige Ladung Frischwasser, da es steil bergauf geht. Bei den hiesigen, stetig tropfenden Kühlern und der totalen Überladung unbedingt erforderlich. Die Jeepneys stammen entwicklungsgeschichtlich von ausrangierten US Army-Jeeps ab, die fantasievoll verlängert wurden. Heutzutage sind es jedoch vollständig handgefertigte Karossen im Kleinbetrieb, so dass jede ein Unikat darstellt, insbesondere was dekorative Bemalung und Ausstattung mit Scheinwerfern betrifft. Die kraftvollen Maschinen und Getriebe stammen allerdings immer aus dem Recyclinggeschäft, Stoßdämpfer scheinen unbekannt zu sein. Vielleicht gehen sie zu schnell kaputt und können daher nicht wiederverwendet werden. Neu sind sie wohl zu teuer. Fast allen Fahrzeugen ist gemeinsam, dass sie über eine sehr funktionelle, da leicht überschaubare Armatur verfügen, wobei meist - wenn überhaupt - nur noch die Batterieanzeige funktioniert. Wozu braucht man auch den Rest, das lenkt nur ab!
10 min nach dem Abzweig zum Dorf Kayasan später zweigt eine schmale Piste zu dem 1 km entfernten
Einheimischendorf Sugod II ab.
Etwa 6 km vor Sabang (einige Abschnitte davon zeigen sich Juli 2008 schon
betoniert, wechseln sich aber immer wieder mit schwerer Piste ab, die in der
Regenzeit katastrophal sein kann - 2011 betoniert!) preist sich ein Botanischer Garten an, für den
Förderungsgelder offensichtlich genauso in den Sand gesetzt wurden, wie für
sicherlich 95%
aller NGO- und GO-Projekte.
Wenige Minuten später weist ein Schild auf ein Angebot des Spelunking Caving
hin. Dieses Angebot ist allerdings zur Zeit (seit 2006, letzter überprüfter Stand 2008) nicht
verfügbar und wenn, dann nur interessant für
Sportkletterer mit eigener Ausrüstung.
Wenige Hundert Meter vor der Küste wurden ebenfalls 2.5 Millionen Pesos mit
freundlicher Beihilfe, diesmal der United Nations, in den Sand gesetzt. Ein Ziegenprojekt und
biodynamischer Anbau sollte es werden, die letzten Ziegen wurden an die
Arbeiter verschenkt, die seit Monaten keinen Lohn mehr gesehen hatten!
Nach gut 1½ Fahrt ab der Abzweigung von der
Küstenstraße (gut 1 h [2008 waren es noch gut 3 h] ab PPC, 81 km - nach einem
Hinweisschild sogar nur 77 km) ist das verschlafene Nest Sabang, ein kleines Fischerdorf mit etwa 800 Einwohnern am
Ende eines weiten Tales erreicht. Flankiert wird es von den Bergen des nördlich liegenden Nationalparks und
dem 800 m hohen Mt. Bloomfield im Süden. Inzwischen gibt es einen großen
Parkplatz für die Vans und Privat-Pkws. Sogar eine durchgehende
Straßenbeleuchtung - beginnend am Paraiso / Bambua - hat Einzug gehalten. Sie
wird mit Windkraft und durch Sonnenkollektoren betrieben.
Hierher nur einen Tagesausflug zu planen ist vermutlich ein sehr grober
Fehler. Fast alle internationalen Reisehandbücher vergessen zu erwähnen,
dass es nicht nur einen langen, schönen Sandstrand gibt - der inzwischen auch
weitestgehend frei von Sandmücken ist, da in vielen
Bereichen tagtäglich geharkt wird -, sondern auch eine Vielfalt von
Unternehmungsmöglichkeiten gibt. Außerdem gibt es eine größere Anzahl von
Unterkünften in verschiedensten Kategorien.
Leider hat es sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass Unterkünfte und
Reiseveranstalter in PPC philippinischen und zunehmend europäischen Touristen eine Packagetour mit AC-Van nach Sabang anbieten: morgens
hin, nachmittags zurück, was intensiv genutzt wird. Dies schadet aber nachhaltig dem
Tourismusgeschäft vor Ort. Auch rasen die Van-Fahrer rücksichtslos durch die
Ortschaften und selbst an Schulen vorbei, was den Ansässigen ein Dorn im Auge
ist, zumal sie keinen Profit davon haben. Dies schürt soziale Unruhe und
nicht selten findet man - zu spät - gut getarnte Bambusstäbchen mit Nägeln,
die auch einigen Mopedfahrern zum Verhängnis werden können. Diese Fallen
können leider nicht zwischen interessierten, langsam fahrenden Touristen und
dem übrigen Mob unterscheiden. Motorradfahrer sollten eine besondere
Vorsicht auch gegenüber den entgegen kommenden Vans walten lassen, da sie
gerne die gesamte Straßenbreite in Anspruch nehmen. Es gab schon schwere
Unfälle, im 1. Halbjahr 2011 sogar einen mit tödlichem Ausgang.
Eine deutliche Erholung des Tourismusgeschäfts in Sabang,
nach der international beachteten Entführung durch die Abbu Sayyaf -
Gruppe, zeichnete sich aber wieder 2005 ab und setzte sich
mit guten Saisons bis 2011 fort. In der Saison werden 7-900 Tagesgäste
gezählt, davon über 95% Einheimische.
In Sabang ist nicht immer und meist nicht alles erhältlich. Die besten
Chancen, wenn gar nichts mehr geht, hat man noch in den Läden
am Pier-Parkplatz und bei Aussan dahinter. Besser
ist es aber, man bringt sich alles persönlich Wichtige aus PPC mit.
Analog PPC gibt es selbst in diesem Nest eine Mülltrennung mit teilweisem Recycling!
Smart bietet eine Cellphoneverbindung an, Globe ist
verzögert gefolgt, Prepaidkarten (Load) kleiner Notation können im Dorf erworben
werden.
Verbindungsausfälle, auch über mehrere Tage (April 2007: 10 Tage, 2011
halbtageweise), sind nicht selten! Es gibt KEINE Banken, Internet
nur im Sheridan und Daluyon. Die Verbindung ist allerdings äußerst langsam,
anscheinend wird jedes Bit mit dem Karabau transportiert. Alle größeren Unterkünfte
verfügen über einen eigenen Generator mit Strombereitstellung ab
frühen Abend, im Sheridan und Daluyon rund um die Uhr. Im Dorf gibt es keinen öffentlichen Generator,
es wird von privat hier und da abgezweigt. Brownouts
sind Gang und Gäbe, eine Taschenlampe ist also immer erforderlich.
Nik-Niks (Sandmücken) sind an den
ungeharkten Sandabschnitten, vor allem an dem Strand hinter dem Mangrovenfluss
saisonweise eine Plage!!! Neben Moskitos konnte
ich auch mehrere Aedes aegypti
beobachten, die das Dengue-Fieber
übertragen können.
 Auf
Grund der nahen Wälder ist es unbedingt empfehlenswert sämtliche Gegenstände
im Zimmer aufzubewahren; Affen sind Kleptomanen! Zudem scheinen Affen
Brillen zu faszinieren, vielleicht auch nur wegen des Geschmacks der
Plastiknasenflügel. Es gibt auch einen, der nun mit meiner Unterhose
herumläuft und dabei Kreuzworträtsel löst.
Auf
Grund der nahen Wälder ist es unbedingt empfehlenswert sämtliche Gegenstände
im Zimmer aufzubewahren; Affen sind Kleptomanen! Zudem scheinen Affen
Brillen zu faszinieren, vielleicht auch nur wegen des Geschmacks der
Plastiknasenflügel. Es gibt auch einen, der nun mit meiner Unterhose
herumläuft und dabei Kreuzworträtsel löst. ![]()
In einigen wenigen Verkaufsständen werden schöne Gegenstände aus poliertem
Ebenholz (Philippinisches Ebenholz 173,)
und Hängematten der Tagbanuwas angeboten. Natürlich fehlen auch die phantasievollen
T-Shirts für die Touris und anderer Tand nicht.
Für den kleinen öffentlichen Verkehr zwischen Sabang
und Cabayugan sind über den ganzen Tag regelmäßig unregelmäßig fahrende Multicabs
und neuerdings auch Tricycles
zuständig. Erstere fahren in der Regel morgens gegen 7 Uhr das erste Mal in Sabang ein, bei Bedarf
nochmals um 10.30, gegen Mittag und Nachmittag und immer etwa eine halbe Stunde
später, spätestens 16 Uhr das
letzte Mal zurück.
300 m vor dem Pier gibt es das Tricycle-Terminal. Zwar muss der Sprit von PPC hergeschafft werden, das
erklärt aber nicht die teils unverschämten Preise. So werden von dort für
die 8-900 m bis zum Bambua 20/Person verlangt, mind. 40 P, von Langnasen teils
noch viel mehr.
Jeepneys fahren 7 und 12 (oder gar nicht) für 220 nach PPC, 120 P bis zur Kreuzung mit dem
Palawan-Highway in Salvacion.
Gegen 14 Uhr fährt noch ein Bus,
der marginal mehr Komfort bietet als die Jeepneys.
Ein special ride in
einem AC-Van kostet 5-6000 P je nach Verhandlungsgeschick nach Port
Barton und PPC, 10-12.000 nach El Nido. Platz ist für 5-8 Personen. Manchmal kann man Fahrer am Parkplatz
auf freie Plätze Richtung PPC ansprechen und für kleines Geld mitfahren.
Nun gibt es auch an mehreren Stellen Mopeds und
Quads zu leihen, was die Flexibilität etwas erhöht, allzuviel kann man
aber nicht abfahren, notfalls kann
man sich an die anderen Verkehrsmittel halten. Während der touristischen Hochsaison gibt es immer mal wieder eine
Fährverbindung
mit einer größeren Banka nach Port Barton
(1200 p.P., 3-4 h; auf der Strecke liegt Cagnipa Island, dort könnte gut ein
Kurzaufenthalt geplant werden!) und El Nido (1500 P, 6½-7 h). Allerdings wird nur gefahren, wenn genügend Touristen
zusammen kommen - was recht selten ist -, die Wellen nicht zu hoch sind und der Motor nicht mal wieder
kaputt ist. In der Nebensaison (ab Ende Mai) wartet man u.U. wochenlang
vergebens.
Einen "relativ" preiswerten Vierrad-Van mit AC findet man bei Dandy
(0927 975 8663) und Dennis (0907 1586 813). Sie verlangen für die Strecke nach
Port Barton 5-6000 für den gesamten Wagen bis max. 4 Personen und bieten auch
eine "relativ" preiswerte Weiterfahrt nach El Nido für 5-6000 P an.
Fast alle sind inkl. BF und bieten Strom per Generator (was i.d.R. auch
einen Fan bedeutet) vom frühen Abend mit kurz nach 23 Uhr an. Wenn
E-Mailadressen genannt wurden, so sind sie mit Vorsicht zu genießen, da -
langsame!! - Verbindungen nur im Daluyon und Sheridan existieren. Und ob alle
in PPC Verwandte haben, die täglich die Mails checken, ist mehr als fraglich.
ACHTUNG: Das gesamte Wassereis, außer in den Luxusherbergen, wird unhygienisch verpackt aus PPC geliefert
und genauso unhygienisch gelagert. In dem Tauwasser befinden sich vermutlich
sämtliche Keime, die auf -itis enden. ICH verzichte auf jeden Eiswürfel oder
Halo-halo, da ich mir so viel Klopapier nicht leisten kann!
 |
 |
| Fangschreckenkrebse (Tagalog: pitik) vorher | nachher |
Stillschweigend setze ich voraus, dass bei einzelnen Gästen dieses Angebot
nicht jeden Abend geboten werden kann. Nachfragen können aber nie schaden!
Übrigens: es wird aus hygienischen Gründen kein Eis für die Getränke angeboten!
Rosalie sagt, ich soll unbedingt schreiben: "Es geht bei uns nicht
professionell zu! Ganz bewusst werden einfache Leute angelernt, die wir auch
von den Batak rekrutieren, um sie durch eine kleine Ausbildung zu fördern.
Über ein wenig Rücksichtnahme für ihr anfangs schlechtes Englisch und
vielleicht einige Ungeschicklichkeiten würden
wir uns freuen."
Da viele biologisch, v.a. ornithologisch Interessierte hierher kommen, die
manchmal wegen nur einem Exoten tagelang ausharren, ein
kurzer Exkurs. Vorweg: Durch den Busch zu laufen, um Natur zu sehen, ist
einmalig. Dabei entdeckt der Forscher viele interessante Pflanzen. Tiere, im
Speziellen Vögel, wird man aber kaum zu Gesicht bekommen,
allerhöchsten hören! Die beste Beobachtungsstelle befindet sich am
Dschungelrand, möglichst an einem erhöhten Standort. Beides kann die
Anlage bieten. Übrigens: Über 95% der Flora v.a. der Fauna, die ich im
Abschnitt "Nationalpark"
beschrieben habe, konnte ich auf diesem Gelände beobachten und das mit einer viel
dichteren Sichtungsrate als im Wald.
Bunte Eis-, gelegentlich Nashornvögel (insbesondere nach längeren
Regenfällen), nachmittags wild fiepende
Eichhörnchen, mit viel Glück (leider sehr selten geworden) vielleicht einmal eine Schlange, eine Affenhorde oder einen Waran kann
man am Dschungelrand der Anlage sehen, wenn man sich z.B. auf der Insel -
die extra für die Vögel angelegt wurde - still verhält und einige u.U. auch ergebnislose Beobachtungsstunden
Zeit hat. Ferner gibt es einen kurzen, aber interessanten Weg durch ein
Stückchen gut durchwachsenen Wald hinter dem Süßwassershrimpteich. An ihm
fielen bis 2008 in der Abenddämmerung zu Dutzenden Silberreiher
177
(mit weißem Kopf und dunklen Beinen und Füßen) und Kuhreiher
92
(mit gelblichem Kopf) ein, die gemeinsam am Weiher
ihren Schlafplatz hatten. Es sollen
auch schon die selteneren Seidenreiher (Egretta garzetta) gesichtet
worden sein. Einige, anscheinend Männchen, kamen dramatisch mit einer
artistischen Landeeinlage daher, wohl um den Damen zu gefallen. Die
anwesenden Kampfrichter gaben dafür: 5.6 - 5.8 - 5.8 - 5.7 - 5.8. Die 6.0
sollte wohl ein Witz sein oder war von dem Philippino. Leider haben
vermutlich die trockenen Jahre 2009-10 die Reiher (vorübergehend?) ausweichen
lassen.
In dem Teich kann übrigens auch gefischt werden. Nicht nur das, sagt man
vorher Bescheid, wird einem auch noch das kalte Bier im Halbstundentakt
herunter gebracht. Selbst ein Lagerfeuer stellt kein Problem dar.
Wer nach der Dunkelheit gut hinhört, kann auch das metallisch rhythmisch-monotone Schlagen
(tschonk-tschonk-tschonk
...) eines bis 30 cm großen Bodenbrüters, der zu der Familie der
Nachtschwalben gehört, bewundern.
Selbst ein Paar der berühmten endemischen Palawanhornvögel konnte von mir
gesichtet werden. Auch ein Pärchen des
extrem seltenen Nachtreihers (Night Heron) gibt es auf dem Gelände, hinzu
kommen noch die witzigen Beos. Ein Glückskind muss
sein, wer noch einen der schneeweißen Kakadus zu
sehen bekommt.
Ornithologen können sich der scheuen Smaragdtaube und an dem seltenen Palawan
Heron (bis 150 cm) erfreuen.
Weitere ausführliche Anmerkungen zur Vogelwelt, auch zu anderen Tieren, im Abschnitt "Nationalpark".
Neben vielen anderen Pflanzen wachsen auf dem Gelände auch ulam-ulam (Tagalog),
deren rispenartigen Blütenstände nur in der Nacht aufgehen und wunderbar
fliederartig riechen. Auch eine Cashew-Plantage (Anacardium occidentale)
findet man vor. Zu Gewächsen (wie kleine Narrabäume,
Borneo-Teak, Blut- oder Alang-Alang-Gras [Philipp. Cogongras auch Kugongras, Imperata cylindrica,
Engl. Cogongrass], viele Blüten- usw., sowie
landwirtschaftlich genutzte Pflanzen) und Tieren
werden gerne Informationen zur Verfügung gestellt.
Weitere - auch hier anzutreffende - Tiere und Pflanzen siehe unter Flora
und Fauna im Wald.
2006 musste das Projekt leider eingestellt werden, teils aus Geldmangel, teils wegen dem unerwartet hohen Interesse der Landwirte und dem damit verbundenen Zeitaufwand. Zudem hat der deutsche Projektleiter Marco eine Anstellung an der Uni Berlin angeboten bekommen. Man sollte es ihm gönnen. Ob es von anderen weitergeführt wird, scheint unwahrscheinlich. Weitere Informationen können (noch?) unter www.ciaap.com abgerufen werden.
Hier der damalige Ansatz und Stand:
Marco Hartmann (m.hartmann@ciaap.com)
studierte Landwirtschaft in Berlin, war 1996 das erste Mal in Sabang und hat
sich hier gleich wohl gefühlt. Nach seinem ersten Lehrgeld mit einer Mangofarm
im Süden Palawans
versucht er nun auf einer 1.5 ha großen
Fläche ein integriertes ökologisches Agrikultur- und Aquakulturprojekt mit lokalem
partizipatorischem Ansatz aufzubauen. Traditionelle Anbaumethoden sollen im Sinne einer Synergie miteinander
verzahnt, mit vor Ort vorhandenen Ressourcen soll ein natürlicher
Kreislauf hergestellt, wobei die Kenntnisse und Erfahrungen der Bauern aus der Umgebung
integriert werden. Anfang 2005 noch in der
Experimentalphase, soll es Mitte des Jahres voll funktionsfähig sein
und ist auf 5 Jahre angelegt. Als Nahziel sollen die Erkenntnisse auf
lokale, dann regionale Strukturen übertragen werden. Fernziel ist eine
Überschusswirtschaft mit der der riesige Markt von PPC erschlossen werden
kann.
Eine am lokalen Markt orientierte Machbarkeitsstudie ergab eindeutig die Wirtschaftlichkeit. Das Land wurde ihm von seinem Freund und
technischen Berater André vom Bambua Nature Park Resort
zur Verfügung gestellt.
Der ökologische Ansatz verlangt auf Chemikalien zu verzichten. So werden
Schädlinge
bekämpft, indem die Felder solange unter Wasser gesetzt werden, bis sie auf ein erträgliches
Maß reduziert sind. Enten werden ohne nennenswerten Raumverlust zur
Fleischgewinnung gehalten und dämmen gleichzeitig die Schnecken in
den Reisfeldern ein, die zudem eine erstklassige Nahrungsgrundlage für das
Federvieh darstellten. Barsche
im Reisfeld sorgen für doppelte Ernte auf
gleichem Raum und vermindern zudem noch effektiv Mückenlarven. Sie werden
erst zu ca. 10.000 in Aufzuchtbecken gehalten und bei Erreichen der
Fingerlinggröße mühsam die Weibchen aussortiert. Nur die Männchen eignen
sich für die Zucht, da sie schneller wachsen.
Während der Trockenzeit werden auf den Reisfeldern als Zwischenfrüchte Kürbisse und Melonen
angebaut.
Ein Süßwassershrimp- und mehrere Barschbecken mit schnell wachsenden Tilapia
zili, Gemüse, Papaya,
Ananas, Bananen, Wasserspinat,
Ziegen, Hühner sowie eine eigene Kompostierungsanlage komplettieren momentan das Projekt.
Möglichst viele Nachbarn mit eigenem Land in der Größenordnung von 0.5 - 2.0
ha sollen nach und nach für diese Idee gewonnen werden. Sie erhalten
eine Schulung auf der Farm und nach Ausbau der eigenen Ressourcen Starthilfe
z.B. in Form von Jungtieren, Setzlingen und technischer Hilfe; eine
"Rückzahlung" könnte in Form von Naturalien erfolgen.
Die nicht profitorientierte Non Gouvernement Organisation CIAAP benötigte ein Startkapital von etwa 10.000 €,
das z.Z. aus privaten Mitteln getragen wird. Für eine Weiterführung des
Projektes ist es jedoch dringend auf Spenden angewiesen. Bis zum Ende des Jahres
2005 soll der Betrieb sich selbst tragen.
Der gesamte Versuch wird wissenschaftlich begleitet, die landwirtschaftliche
Fakultät der Universität in PPC hat begeistert Interesse
angemeldet, Marco selbst steht in intensivem Kontakt mit seinen ehemaligen
Professoren in Berlin, die in gerne unterstützen.
 Heute
ist der 26. März 2005, der Jahrestag der Einweihung (1971) des Nationalparks wird
gefeiert. Und man hat sich nicht lumpen lassen. Die bekannteste Ethnomusikgruppe
Palawans, die sich Sinika nennt, wurde engagiert. Schon am Vormittag werden am
Pier die Elektrogeräte aufgebaut, den ganzen Tag plärrt jemand ins Mikrofon,
einmal scheint es sich um einen Quiz, das andere Mal um eine Verlosung zu
handeln, jedoch der Sinn des überwiegenden Teils bleibt mir verborgen. Das
ganze Dorf ist auf den Beinen, kostet es doch keinen Eintritt, sogar einige
Touristen haben sich dazu gesellt. Um 20 Uhr wird es dann ernst, einer nach
dem anderen aus der lokalen und regionalen Politprominenz, der örtlichen,
übergeordneten, leitenden und obersten Naturschutzbehörde, die Vereinigung
der Ranger und Bootsleute - fehlt nur noch der Toilettenmann Vincent - geben
sich nacheinander das Mikrofon in die Hand; erstaunlicherweise hören viele
zu. Auch an die "Nativen" aus den Bergen hat man gedacht. Gekleidet
in ihre traditionelle Kluft darf ein Paar einen mehr oder weniger gelungenen
Tanz zu Bongotrommelklängen hinlegen. Aber offensichtlich hat der Sohn des
Tänzers die Trommel nicht richtig geschlagen. Während der gute Batak ihn zu
belehren versucht, eilt jemand zu dem Mikro und bedankt sich für diese
"traditionelle Einlage". Ein beschämendes, fast schon
entwürdigendes Trauerspiel, ist es doch ganz offensichtlich, dass die
"Einlage" noch gar nicht richtig begonnen hatte. Die Darsteller
scheinen es zu merken und verkrümeln sich rasch.
Heute
ist der 26. März 2005, der Jahrestag der Einweihung (1971) des Nationalparks wird
gefeiert. Und man hat sich nicht lumpen lassen. Die bekannteste Ethnomusikgruppe
Palawans, die sich Sinika nennt, wurde engagiert. Schon am Vormittag werden am
Pier die Elektrogeräte aufgebaut, den ganzen Tag plärrt jemand ins Mikrofon,
einmal scheint es sich um einen Quiz, das andere Mal um eine Verlosung zu
handeln, jedoch der Sinn des überwiegenden Teils bleibt mir verborgen. Das
ganze Dorf ist auf den Beinen, kostet es doch keinen Eintritt, sogar einige
Touristen haben sich dazu gesellt. Um 20 Uhr wird es dann ernst, einer nach
dem anderen aus der lokalen und regionalen Politprominenz, der örtlichen,
übergeordneten, leitenden und obersten Naturschutzbehörde, die Vereinigung
der Ranger und Bootsleute - fehlt nur noch der Toilettenmann Vincent - geben
sich nacheinander das Mikrofon in die Hand; erstaunlicherweise hören viele
zu. Auch an die "Nativen" aus den Bergen hat man gedacht. Gekleidet
in ihre traditionelle Kluft darf ein Paar einen mehr oder weniger gelungenen
Tanz zu Bongotrommelklängen hinlegen. Aber offensichtlich hat der Sohn des
Tänzers die Trommel nicht richtig geschlagen. Während der gute Batak ihn zu
belehren versucht, eilt jemand zu dem Mikro und bedankt sich für diese
"traditionelle Einlage". Ein beschämendes, fast schon
entwürdigendes Trauerspiel, ist es doch ganz offensichtlich, dass die
"Einlage" noch gar nicht richtig begonnen hatte. Die Darsteller
scheinen es zu merken und verkrümeln sich rasch.
Schließlich steht um 21 Uhr die Band auf der Bühne, bis dahin kam auch das
EU-Wartehäuschen zum Einsatz, ausnahmsweise darf man heute hier rauchen. Die
Stimmung ist großartig, bald fängt eine zunehmend wüste Tanzerei an, deren
Stilrichtung ich nicht bestimmen kann, sicherlich waren San Miguel, Red Horse
und Tanduay literweise mit von der Partie. Wie in Südostasien weit verbreitet
erntet die Gruppe den Beifall zu Beginn des Stückes, am Ende herrscht
Grabesstille, bis ein neues Lied angestimmt wird. Sinika spielt einen
Ethnosound, der stark mit spanischen Elementen durchsetzt ist. Aber auch
westliche Rockstücke haben sie auf Lager, das heizt die Stimmung zusätzlich
an. Zwei Stunden dauert der Auftritt, dann wird die Band durch dröhnende
Konservenmusik ersetzt, die sich kaum von einer westlichen Hardcore-Disco
unterscheidet. Heute läuft der Dorfgenerator die halbe Nacht durch, erst weit
nach Mitternacht versickern die Einwohner in ihre Hütten. Taschenlampen sind
heute nicht notwendig, entweder hat man selbst ganz schön die Lampe an oder
der senkrecht stehende Vollmond weist den Weg.

Es ist unbedingt erforderlich am Pier von Sabang ein Eintrittsformular für 200 für den Fluss + 30 für den Nationalpark zu erstehen, sonst kann es passieren, dass man den langen Anmarschweg wieder zurück muss! Für 700 erhält man ein Returnticket für die gesamte Bankas (max. 6 Personen), 600 kostet die einfache Fahrt, die Paddelbankas am Untergrundfluss mit Führer sind immerhin im Preis enthalten. Empfehlenswert ist es zuerst mit dem Boot früh morgens (ab 8 Uhr) am Pier abzulegen, da dann noch nicht soviel Betrieb herrscht und bei gemütlichem Tempo einen der Trails zurück zu nehmen.
1971 gegründet (weil Marcos nicht genügend Schmiergeld von den Logging Companys bekam und sich so "gerächt" hat, so die Auskunft von Expats), 1999 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt umfasst der Park 3901 ha und wird von einer geschützten Pufferzone von 18.301 ha umgeben.
Ein kleines Problem ist für den Rückweg am Poyuy-poyuy - Fluss entstanden: Die Brücke ist weg - niemand kümmert sich trotz der hohen Einnahmen um einen Neubau. U.U. muss man einige Zeit warten, bis jemand greifbar ist, der einen hinüberpaddelt (bei viel Regen ist die Strömung zu stark, kommt noch die Flut hinzu, ist es schlicht zu tief). Es soll in absehbarer Zeit eine Hängebrücke eingerichtet werden - so die Aussage 2008. (Stand 2011)
 Skizze des unterirdischen Flusssystems mit freundlicher
Genehmigung © Hendrik
Freitag. (Gepunktet = unerkundet.)
Skizze des unterirdischen Flusssystems mit freundlicher
Genehmigung © Hendrik
Freitag. (Gepunktet = unerkundet.)
Die touristische Hauptattraktion ist der etwa 8.2 km lange und mit 4.3 km längste schiffbare Untergrundfluss der Welt, der unter dem Massiv des Karstgebirges mit dem 1027 m hohen Mt. St. Paul (benannt nach einem Offizier der englischen Marine) und dann in das Südchinesische Meer fließt. Allerdings sind nur die ersten 1.2 km des Systems für die Paddelbankas freigegeben, darüber hinaus bedarf es einer Sondergenehmigung (über die man, bei vortägiger Buchung, z.B. im Paraiso verfügt). Geologen schätzen das Alter auf 23 Millionen Jahre.
Eingestürztes Deckgebirge hat tief im Berg einen gewaltigen Dom geschaffen, im Boot mitgeführte
autobatteriebetriebene Lampen können die mit 65 m höchsten Stellen kaum noch
erreichen. Der Fluss ist teilweise über 9 m tief, das glasklare Wasser (in der
Regenzeit trüb und gelb) täuscht erheblich
geringere Tiefen vor. Vielerorts haben sich Stalagmiten und Stalaktiten
(Eselsbrücke: "-titten", ja, genau, das sind die, die von oben nach unten hängen),
Orgelpfeifen, Vorhänge und Dome gebildet, die allerdings im Großen und Ganzen
nicht besonders spektakulär sind. Umso fantasievoller sind die
vergebenen Namen: da gibt es eine ganze Obstabteilung, Jesus und die Kirche
werden bemüht, Filmstars und sogar ein Dinosaurier müssen herhalten. An
einigen Stellen ist das Calciumcarbonat schön auskristallisiert, so dass es wie
Diamantenstaub glitzert, bei einer anderen Passage gibt es unter der Decke sogar
einen "God's Highway". Die Informationen der Führer sind umfassend und gut,
allerdings könnten sie ruhig öfter mal den Schnabel halten, damit man die
unwirkliche Atmosphäre genießen kann. Sie sind aber offensichtlich gezwungen
ihr Programm abzuspulen, selbst bei der Gehörlosengruppe, mit der ich unterwegs
war.
Verlässt man den Bereich, den 99.99% der Besucher besichtigen, wird es bald
still. Sehr still. Von herabfallenden Wassertropfen, Schwalben und Fledermäusen
und dem Paddelgeräusch einmal abgesehen. Immer wieder trifft man auf
Felsmarkierungen, die bis in das Anfang des 20. Jahrhunderts zurückdatieren. An
vielen Stellen haben sich meterhohe Lehmbänke abgelagert. Noch ist es nicht
verboten, sich etwas davon mitzunehmen. Schließlich verschwindet der
Untergrundfluss endgültig im Untergrund, von hier ab kommen nur noch
professionelle Höhlenforscher mit Tauchgeräten weiter.
Neben Schwalben finden hier schätzungsweise 40.000 Zwergfledermäuse
der Familien Rhinolophidae (Hipposideros diadema, Rhinolophus virgo, R.
arcuatus, R. inops) und Vespertilionidae (Miniopterus tristis, M.
schreibersii, M. australis, Myosis macrotarsus) ihre tägliche Herberge.
Ist herabtropfendes Wasser kalt, so handelt es sich um durchsickerndes
Grundwasser, ist es warm dann nicht. Darum sollte man beim Blick nach oben auch
den Mund geschlossen halten. ![]()
Der deutscher Biologe Hendrik Freitag vom AQUA Palawana Programm http://aquapalawana.nhm-wien.ac.at
hat das gesamte System des unterirdischen
Cabayugan River (so dessen Bezeichnung vor dem Eintritt in die Höhle) in den Jahren 2000/2001 intensiv
untersucht und dabei zahlreiche neue Arten der palawanischen Süßwasserfauna zu
Tage befördert. So ist beispielsweise die im Oberlauf des Flusses häufig
anzutreffende Flusskrabbe (kürzlich benannt als Parathelphusa cabayugan)
eine neue endemische Art. Im unterirdischen Abschnitt des Flusses fand sich eine
bisher nur von den südjapanischen Ryukyu-Inseln bekannte Garnele, deren
Augenpigmentierung in Anpassung an die subterrane Umgebung stark reduziert ist.
Die wissenschaftliche Beschreibung (Veröffentlichung des Neuarten-Status) der
Insekten ist gerade in vollem Gange und wird sicher weitere spannende Aspekte der hiesigen Biodiversität aufzeigen
http://aquapalawana.nhm-wien.ac.at/results_de.htm. Dabei besteht z.Z. die Möglichkeit eine
Taufpatenschaft http://aquapalawana.nhm-wien.ac.at/coccinella_de.htm
für eine der neu entdeckten Wasserkäferarten aus dem
Nationalpark zu übernehmen. Gegen eine Spende wird dann ein offizieller wissenschaftlicher Name nach individuellem Wunsch (z. B.
eurem Vor- &
Zunamen) vergeben.
Die Ergebnisse mündeten in einer
Doktorarbeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und können als
Abstract eingesehen werden. Bei tiefer gehendem Interesse kann auch die Western
Philippines University in Sta. Monica, Puerto Princesa diesbezüglich konsultiert werden, an
der mehrere deutsche Wissenschaftler tätig sind und waren.
Die offizielle Karte (sic!) des Nationalparks enthält einen Trail,
der direkt hinter der Brücke entlang des Poyuy-poyuy- oder Sabang-Flussufers ins Landesinnere
abbiegt und auf den Dschungeltrail Richtung Rangerstation führen soll. Eine derartige
Karte ungeprüft in ein Reisehandbuch (schon 2005 moniert und selbst noch in der
Auflage 2008 vorhanden!) zu übernehmen ist sehr
zu kritisieren! Der eigentlich recht
schöne, aber nicht weiter ausgeschilderte Fußpfad splittet sich nach ein paar
Hundert Metern in mehrere Fußpfade auf. Hier haben sich schon Menschen
stundenlang verirrt. Ein Fall ist mir bekannt, wonach ohne Wasser und Proviant
und dann noch bei heftigem Regen eine Übernachtung im Wald notwendig wurde. Am
nächsten Morgen hat man sich durchs Unterholz geschlagen, ist dann einem
Motorengeräusch gefolgt und kam ziemlich verkratzt, zerstochen und mit den Nerven fertig an
der Straße an. Wenn überhaupt, dann nur die
markierten Haupttrails nutzen, ansonsten sind Führer erforderlich!
Erfahrene Wanderer (an Repellent denken!) können sich entlang der später
auftauchenden Felswand parallel zum Grenzfluss (natürlich ist an die
Parkgebühr zu denken!) durchschlagen, anschließend ist ein
Schraubenpalmengebiet zu durchqueren. Hinter einer Mäanderbiegung führt links
ein in der Trockenzeit weitgehend wasserarmes Flussbett tiefer in den Park
hinein. An einer großen Flussgabelung steht ein imposanter, mächtiger Baum.
Hier kann man den linken Ast - ich meine den vom Fluss - wählen, der durch ein
schönes, enges und abenteuerlich wirkendes Tal verläuft. Viel weiter sollte
man sich aber nicht alleine vorwagen (nur mit Führer) und lieber umkehren, besonders bei der
Gefahr eines Regenschauers in den Bergen! Bei einem Sturzbach gibt nicht viele
Möglichkeiten seitlich hinauf zu flüchten.
 Es werden zwei Trails
parallel zur Küste durch den Nationalpark angeboten: der etwas
einfachere Monkey Trail mit 4.8 km (gut ausgebaut und
überwiegend mit Betontrittstellen) und der alternativ abzweigende, unbefestigte Jungle-Trail
(in der Trockenzeit mit festen Sandalen machbar,
besser Sportschuhe) mit 4.7 km. Sehr gut ausgeschildert und farbmarkiert, also nicht zu
verfehlen, macht er einen Führer absolut überflüssig. Bei den Anstiegen helfen
insgesamt 355 Holz- und 386 Steinstufen, die 100 Männer
in 15tägiger Arbeit geschaffen haben. Besonders am Untergrundfluss und dem
Anstieg von dort hält sich eine Makakensippe
148
auf, die recht aggressiv sein kann. André vom Bambua gab dazu den Tipp:
"Den Tieren nicht in die Augen sehen, das macht sie u.U. als Gruppe
angriffslustig. Besser auf den Boden schauen und zügig weiter gehen."
Einen Spazierstock habe ich mir für alle Fälle dennoch mitgenommen.
Es werden zwei Trails
parallel zur Küste durch den Nationalpark angeboten: der etwas
einfachere Monkey Trail mit 4.8 km (gut ausgebaut und
überwiegend mit Betontrittstellen) und der alternativ abzweigende, unbefestigte Jungle-Trail
(in der Trockenzeit mit festen Sandalen machbar,
besser Sportschuhe) mit 4.7 km. Sehr gut ausgeschildert und farbmarkiert, also nicht zu
verfehlen, macht er einen Führer absolut überflüssig. Bei den Anstiegen helfen
insgesamt 355 Holz- und 386 Steinstufen, die 100 Männer
in 15tägiger Arbeit geschaffen haben. Besonders am Untergrundfluss und dem
Anstieg von dort hält sich eine Makakensippe
148
auf, die recht aggressiv sein kann. André vom Bambua gab dazu den Tipp:
"Den Tieren nicht in die Augen sehen, das macht sie u.U. als Gruppe
angriffslustig. Besser auf den Boden schauen und zügig weiter gehen."
Einen Spazierstock habe ich mir für alle Fälle dennoch mitgenommen.
Der Jungle-Trail weist zwei recht steile
An-/Abstiege auf und ist
bei geringem Tempo - gerechnet allerdings mit Pausen - bis zum Pier
mit 2½-3 Stunden zu veranschlagen, für den Monkey Trail ½ h weniger. Hier
gibt es nur einen steilen An- und Abstieg, sowie zwei weitere leichte. Etwa 730
m vor dem Untergrundfluss trennen sich die beiden Pfade, bzw. münden ineinander. Der Vorteil des Monkey
Trails ist, dass er etwa zur Hälfte direkt an der Küste entlang führt,
wodurch oft eine Brise den im eigenen Saft stehenden Körper erfrischt. 1.5 km
entfernt vom Untergrundfluss gibt es auch noch eine schöne Bucht mit einem einsamen
Sandstrand. Unter dem großen Indischen Korallenbaum
96 (Tagalog = dap-dap) direkt nach dem
Abstieg findet man auch prima
Schatten. Allerdings sollte man sich nach der Tide erkundigen: Bei Hochwasser
kommt man an einem Felsenvorsprung nicht trocken vorbei. Erst recht nicht bei
starkem Wellengang! Bei Regen gibt es eine trockene Unterstellmöglichkeit
hinter dem Felsenvorsprung mittig des zweiten Strandabschnittes unter einem 10 m hohen
Felsdach. Offiziell darf man hier nicht schwimmen, ... .
Am dem Sabang zugewandten Ende des Strandes befindet sich an der Hochwasserlinie
ein mächtiger Baum, der zu den Mangrovengewächsen gehört. Auffallend sind die
schönen, leicht duftenden Blüten mit weißem bis cremefarbenem Boden und bis 10 cm langen,
lachsfarbenen bis dunkelroten, pinselartigen Staubblätter (Pollengefäße). Die
nussartigen Früchte können bis zu zwei Jahre im Meerwasser schwimmen und bleiben
keimfähig. Sie werden von einigen Einheimischen zerstoßen und zusammen mit
Muschelfleisch in Gewässer
gegeben, um mit den darin enthaltenen Saponinen (div. Steroidalkaloide) Fische zu
betäuben und abzusammeln.


Barringtonia asiatica, Indon. bitung
Ein entsprechender Wasservorrat (mind. 1 l), ein kleiner Snack und eine minimale Erste-Hilfe-Packung sind Pflicht. Ebenso ein Repellent gegen die manchmal recht lästigen Moskitos und Sandmücken. Bis 15°° ist der Rückweg einzuschlagen, dann werden sie offiziell geschlossen und letztmalig von den Rangern (wenn überhaupt) begangen. Verletzte, gehunfähige Wanderer müssen dann mit einer ungewollten Übernachtung rechnen.
Ein kleines Problem ist für den Rückweg am Poyuy-poyuy - Fluss entstanden (Juli 2008): Die Brücke ist weg - seit Monaten kümmert sich niemand trotz der hohen Einnahmen um einen Neubau. U.U. muss man einige Zeit warten, bis jemand greifbar ist, der einen hinüberpaddelt (bei viel Regen ist die Strömung zu stark, kommt noch die Flut hinzu, ist es schlicht zu tief). Es soll in absehbarer Zeit eine Hängebrücke eingerichtet werden. Eigentlich eine Unverschämtheit, dass niemand darauf aufmerksam macht!
Dieser einzigartige, sehr seltene Karst-Dschungel, der nur 2% der philippinischen Regenwaldfläche ausmacht, ist ein halbtrockener Regenwald. Als Karst bezeichnet man ein mit Klüften und Hohlräumen durchsetzten Kalkstein; ein Analogon findet man im jugoslawischen Karstgebirge (fragt mich nicht, in welchen Nachfolgestaat das jetzt liegt). Die Trockenheit, das Aufheizen des hellen Gestein in der grellen Tropensonne, dann wieder sintflutartige Regenfälle haben eine starke evolutionäre Auslese betrieben. Kein Wunder, dass sich in dem tropischen Wald auch etliche Sukkulenten befinden: Kakteenartige wie Euphorbia trigona, Arisema, Pleomele und Schefflera-Arten.
Über 800 Pflanzenarten aus 300 Gattungen und gut 100 Familien, darunter einige spezialisierte Kakteen, 295 Baumarten, hauptsächlich Dipterocarpaceen, stellen den größten Teil der Vegetation. Die Samen des Calophyllum inophyllum (Tagalog bitaog) werden einigen Ökofreaks bekannt sein: Er enthält ein grüngelbliches Öl, das als natürliches Heilmittel für Hauterkrankungen und Rheumatismus verwendet wird. Ferner findet es als "dermatologisch wertvoller Zusatz" zu Seifen und als Möbellack Verwendung, für die Einheimischen ist es Brennstoff für ihre Lampen. Der Baum blüht von März bis August. Der NATO-Baum (Pelaquaium lizonogsis) hat nix mit der gleichnamigen Vereinigung alter Haudegen zu tun. Sein Holz dient als Schiffsplanken der Seefahrt und verhilft den Musikern zu Instrumenten. Ipil (Tagalog) ist Intsia bijuga, gehört zu den Leguminosen und muss von mir noch genauer untersucht werden.
 Sie wird u.a. von 168 Vogelarten, die 67% der philippinischen Vogelwelt
repräsentieren - davon 15 endemisch - bewohnt. Darunter befindet sich das Symbol von Puerto Princesa, dem vom Aussterben bedrohten
Palawanpfaufasan (Polyplectron
emphanum, Palawan Peacock-Pheasant, - bis 50 cm), der am Camp angefüttert
wurde. Auch Nektarvögel (oder Honigsauger) (wie der Grünrücken-Nektarvogel Nectarina jugularis aurora, Olive backed
Sunbird, rechts) können an Blüten beobachtet werden. Sie
haben eine konvergente Evolution analog der Kolibris in der Neuen Welt durchgemacht
und beherrschen den Schwirrflug, wenn auch nicht in dem Maße wie ihrer Kollegen
auf der anderen Seite des Globus. Selten zu sehen, da überwiegend in den
Baumkronen, dafür am rhythmisch rauschendem Flügelschlag und deutlichem Ruf erkennbar,
sind die ebenfalls endemischen, stark gefährdeten Palawanhornvögel (Anthracocerus marchei,
Tagalog kalaw, Palawan Hornbill, Nashornvogel siehe auch 137)
mit ihrem weißen
Schwanzfächer.
Sie wird u.a. von 168 Vogelarten, die 67% der philippinischen Vogelwelt
repräsentieren - davon 15 endemisch - bewohnt. Darunter befindet sich das Symbol von Puerto Princesa, dem vom Aussterben bedrohten
Palawanpfaufasan (Polyplectron
emphanum, Palawan Peacock-Pheasant, - bis 50 cm), der am Camp angefüttert
wurde. Auch Nektarvögel (oder Honigsauger) (wie der Grünrücken-Nektarvogel Nectarina jugularis aurora, Olive backed
Sunbird, rechts) können an Blüten beobachtet werden. Sie
haben eine konvergente Evolution analog der Kolibris in der Neuen Welt durchgemacht
und beherrschen den Schwirrflug, wenn auch nicht in dem Maße wie ihrer Kollegen
auf der anderen Seite des Globus. Selten zu sehen, da überwiegend in den
Baumkronen, dafür am rhythmisch rauschendem Flügelschlag und deutlichem Ruf erkennbar,
sind die ebenfalls endemischen, stark gefährdeten Palawanhornvögel (Anthracocerus marchei,
Tagalog kalaw, Palawan Hornbill, Nashornvogel siehe auch 137)
mit ihrem weißen
Schwanzfächer.
Mit Glück und wenn man sich still verhält, kann man auch
scheue, prächtig metallisch glänzende philippinische Eisvögel, eine Art mit
blauem Rücken, gelbem Kopf und Brust sowie leuchtend orangerotem Schnabel: der
Storchschnabelliest (Pelargopsis capensis, Stork-billed Kingfisher, bis
37 cm) 146, aus nächster Nähe
bei ihrer Sturzflugjagd beobachten. Am späten Nachmittag ist der Philippinische
Weißbauchseeadler (Heliaeetus leucogaster, Bild)
145
zu Gast, oft entlang der Küstenlinie majestätisch seine Kreise ziehend. Mit seinen breiten
Schwingen, weißem Kopf und weißer Brust ist er schon auf größerer Distanz
auszumachen. Einer befindet sich in der Nähe von Sabang. Da er eine Leine an
einem Fuß trägt, ist er wohl aus Gefangenschaft entflohen. Dazu spricht auch
sein Verhalten, arglosen Passanten den frisch gekauften Fisch aus der Hand zu stibitzen.
Wer früh morgens ankommt kann vielleicht auch noch ein paar
Papageien, z. B. der Blaunackenpapagei (Tanygnathus lucionensis
paraguenus, Tagalog pinoy, Blue-naped Parot) oder einen der grünen Papageien
(Prioniturs platenae, Tagalog kilit, Blue headed Raquet-tail) sehen. Ein Glückskind muss sein, wer noch einen der schneeweißen - Schwanzfedern und Flügel unten gelblich -
 Philippinischen Rotsteißkakadus
(Cacatua haematuropygia, Philippine Cockatoo, - bis 30 cm) zu sehen bekommt, der lange Zeit exportiert wurde und dessen Population nun zusammengebrochen ist. Die meisten wurden weggefangen und sind
inzwischen in der Käfighaltung oder zoologischen Gärten eingegangen. Gar nicht
so selten ist der Rote Dschungelhahn (Gallus gallus, Tagalog Labuyo, Red
Jungle Fowl), den man nicht mit einem verwilderten Misthaufenkönig verwechseln
sollte. Eine Rarität, aber mit einer etwas höheren Chance ihn zu beobachten,
ist der bunte
Chestnut-breasted Malkoha (auch Malcoa, Phaenicophaeus curvirostris, bis 49
cm, links [Yellow-billed Malkoha
Rhamphococcyx calorhnychus, in der engl. Wikipedia von 8/2011 verlinkt auf Phaenicophaeus
calyorhynchus, der dort nur auf Indonesien verortet wird; ein Trugschluss,
wie das Foto nachweist!)] mit
einem auffälligen langen Schwanz.
Philippinischen Rotsteißkakadus
(Cacatua haematuropygia, Philippine Cockatoo, - bis 30 cm) zu sehen bekommt, der lange Zeit exportiert wurde und dessen Population nun zusammengebrochen ist. Die meisten wurden weggefangen und sind
inzwischen in der Käfighaltung oder zoologischen Gärten eingegangen. Gar nicht
so selten ist der Rote Dschungelhahn (Gallus gallus, Tagalog Labuyo, Red
Jungle Fowl), den man nicht mit einem verwilderten Misthaufenkönig verwechseln
sollte. Eine Rarität, aber mit einer etwas höheren Chance ihn zu beobachten,
ist der bunte
Chestnut-breasted Malkoha (auch Malcoa, Phaenicophaeus curvirostris, bis 49
cm, links [Yellow-billed Malkoha
Rhamphococcyx calorhnychus, in der engl. Wikipedia von 8/2011 verlinkt auf Phaenicophaeus
calyorhynchus, der dort nur auf Indonesien verortet wird; ein Trugschluss,
wie das Foto nachweist!)] mit
einem auffälligen langen Schwanz.
Es gibt auch noch einen nicht Identifizierten: Vermutlich ein Fall für den
Internationalen Haager Gerichtshof. Aufgrund seines mitleiderregenden, leidenden
Geschreis aus dem tiefen Busch schließe ich, dass er offensichtlich entgegen
der Genfer Konvention gefoltert wird. Einige sind anderer Auffassung und nennen
ihn Orgasmus-Vogel. ![]() (Möglicherweise der Mangrove-Cuckoo oder die Little Cuckoo-Dove.) Vor- und
nachmittags hört man das glucksende, metallische Flöten des Schwarznackenpirols 164.
Dieser bis 27 cm große, auf dem Rücken goldgelb und schwarz gefärbte Vogel
mit orangem Schnabel fliegt in einer typischen undulatorischen Weise, kommt
häufig in Südostasien vor und ist oft am Rande Kokosnuss- und Bananenplantagen
anzutreffen. Schließlich seinen noch erwähnt: die bis 45 cm große, 365 g
schwere (!) Green
Imperial Pigeon (Ducula aena) mit auffälligen grünen Flügeldecken und
weißer Unterseite. Neben vielen anderen gibt es noch die scheue Smaragdtaube
(Chalcophaps indica, Common Emerald Dove, bis 25 cm) und den seltenen Palawan Heron
(bis 150 cm). Der Philippinische Kuckuck (Centropus viridis viridis,
Tagalog [T]Sabukot, Lesser
Coucal, bis 45 cm) fällt durch einen sehr langen Schwanz
und rostbrauner Flügeldecke sowie einem metallisch tiefblaugrünen Rücken auf.
Er hält sich gerne in dem hohen Gras der Reisdämme, aber auch im Unterholz
auf. Ein Merkmal ist sein sehr bodennaher Flug und ein
rhythmisch-monotones einfaches oder mehrfaches Schlagen (chonk-chonk-chonk ...),
als ob Wassertropfen auf eine sehr dünne Metallplatte fallen.
(Möglicherweise der Mangrove-Cuckoo oder die Little Cuckoo-Dove.) Vor- und
nachmittags hört man das glucksende, metallische Flöten des Schwarznackenpirols 164.
Dieser bis 27 cm große, auf dem Rücken goldgelb und schwarz gefärbte Vogel
mit orangem Schnabel fliegt in einer typischen undulatorischen Weise, kommt
häufig in Südostasien vor und ist oft am Rande Kokosnuss- und Bananenplantagen
anzutreffen. Schließlich seinen noch erwähnt: die bis 45 cm große, 365 g
schwere (!) Green
Imperial Pigeon (Ducula aena) mit auffälligen grünen Flügeldecken und
weißer Unterseite. Neben vielen anderen gibt es noch die scheue Smaragdtaube
(Chalcophaps indica, Common Emerald Dove, bis 25 cm) und den seltenen Palawan Heron
(bis 150 cm). Der Philippinische Kuckuck (Centropus viridis viridis,
Tagalog [T]Sabukot, Lesser
Coucal, bis 45 cm) fällt durch einen sehr langen Schwanz
und rostbrauner Flügeldecke sowie einem metallisch tiefblaugrünen Rücken auf.
Er hält sich gerne in dem hohen Gras der Reisdämme, aber auch im Unterholz
auf. Ein Merkmal ist sein sehr bodennaher Flug und ein
rhythmisch-monotones einfaches oder mehrfaches Schlagen (chonk-chonk-chonk ...),
als ob Wassertropfen auf eine sehr dünne Metallplatte fallen.
Der in Asien beliebte "sprechende" Beo 159
(Gracula religiosa, Tagalog Kiao) irritiert oft anderer Vögel durch
Rufnachahmung, imitiert Handy-Klingeltöne, Husten und Lachen, einige Worte und
kurze Sätze und sorgt so für einiges an Belustigung. Umso trauriger ist seine
Käfighaltung. Im Park kann man ihn noch in freier Natur antreffen. Wiederum endemisch auf Palawan, ist der
sonst selten zu sehende Palawan Shama (Copsychus niger, White-vented Shama, bis 20
cm, rechts).
Erkennbar ist er an seiner weißen Schwanzunterseite und seinem
abwechslungsreichen, melodischem Gesang. Er lässt sich mit einigen seiner
einfacheren Rufe auch leicht anlocken und sorgt dann für eine schöne
Unterhaltung.
Ab der späten Dämmerung kann man auch den bis 26 cm großen, nachtaktiven Bodenbrüter, die Philippinen-Nachtschwalbe (Caprimulgus macrurus,
Tagbanuwa
patur-tur, Malaya tok-tok, Large-Tailed Nightjar) der zu der Familie der
Nachtschwalben aus der Gattung der Ziegenmelker gehört, bewundern. Dieser von der Silhouette her falkenähnliche, aber näher mit den Eulen
verwandte, hat sich auf die Jagd von Insekten spezialisiert. Auch um
einen ausgesprochenen Nachtvogel handelt es sich bei der Seloputo Eule. Um die
Aufzählung der interessantesten Vogelarten einigermaßen zu komplettieren, hier
noch der Black-naped Monarch (Hypothymis azarea) und der
blau-schwarzmetallische Glanzfleckdrongo (Dicrurus
hottentottus, Spangled Drongo auch Hair-crested Drongo, bis 32 cm) mit seinem gegabelten
"Fischschwanz".
P.S.: Über 95% der Vogelbeobachtungen habe ich im Bambua
gemacht und das mit einer viel höheren und dichteren Sichtungsrate als im Wald.
41 Schmetterlingsarten aus 6 Familien, der mit 18 cm Flügelspannweite größte, der schwarze, schwalbenschwanzartige Trogonoptera trojana
(Papilio trojano in einem englischen Bestimmungsbuch) mit brillanten grünen Dreiecken auf dem hinteren Rand seiner Flügel und - man mag es kaum glauben wer dies gezählt
hat - 23.779 Arten von Insekten, Mollusken (Weichtiere) und Arthropoden
(Gliederfüßler) listet die Statistik
auf. Zu den weniger
erfreulichen Insekten dürften die
Moskitos und
Sandmücken (Repellent mitnehmen!) gehören.
Der lautstarke Gesang der Zikaden (Tagalog kuliglig) ist da schon angenehmer,
wenn auch der Eindruck entsteht, dass einige bei einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler in die Lehre
gegangen sind und dessen Warnton übernommen haben.
30 Säugetiere wurden
bestimmt, wie der Langschwanz-Makake
148
(Macaca fascicularis, Tagalog ungoi / tsonggo), der häufig an den Wanderwegen und am Camp des Untergrundflusses anzutreffen ist.
Es ist die einzige auf den Philippinen anzutreffende Affenart. Erheblich seltener,
da im Bestand bedroht, trifft man auf die nachtaktive, endemische Bärkatze oder
Marderbär, zur
Familie der Schleichkatzen gehörend (Foto; Arctictis binturong, [whitei], Tagalog binturong / manturon,
Bear Cat),. Öfter dagegen schon mal das
Palawan-Hörnchen (squirrel, Sundasciurus spec.) mit seinem buschig roten
Schwanz, eine der beiden endemischen Arten der Sunda-Baumhörnchen. Auch nicht
selten ist das Wildschwein (Sus barbatus, Tagalog baboy-damo, Wild Boar),
das Palawan Stachelschwein (Hystrix pumila + Thecurus pumilus, Palawan Porcupine) dagegen
sehr. Besonders an den Karstdschungel angepasst und recht häufig kommen vor:
die Palawan Baumspitzmaus (Tupai[a?] palawanensis, Palawan Tree Shrew) und
der Palawan "Stinkdachs" (? - Mardaus marchii, Palawan Stink Badger).
Leichter sind kleinere Exemplare der Bindenwarane (Varanus salvator, Tagalog bayawag, Monitor Lizard 147) am Camp des Untergrundflusses zu sehen, die sich an den Abfällen gütlich tun. Ausgewachsen erreichen sie bis zu 2 m, können 50 kg schwer werden und die größten Echsen der Philippinen. Ihre Haut ergibt ein begehrtes Leder, was sie an den Rand des Aussterbens brachte. Neben einigen Leckereien wie Eier, Früchte, Insekten, Hühner, kleine Säugetiere, verschmähen sie auch Aas nicht und stellen somit eine Art Hygienepolizei im Dschungel dar. Es sind gute Baumkletterer und Schwimmer. Sie stellen eine der 19 Reptilienarten, zu denen auch die nicht besonders seltene Königs-, möglicherweise auch Speikobra (Ophiophagus hannah respektive Naja sputatrix bzw. Naja sumatrana) gehört. Auch die Netzpython (Python reticulates, Tagalog sawa) und die Pit Viper (Tagalog mandasaw) kommen hier vor. 10 Amphibia komplettieren den natürlichen Zoo.
Foto: © ingo66@web.de
Lobenswert sind die Lehrtafeln an den touristischen Sammelpunkten und Beschilderungen einiger Bäume. Weniger verständlich ist, warum man neben dem einheimischen und wissenschaftlichen Namen, sowie teilweise der Verwendung, nicht auch gleich noch den englischen Namen angibt. Zurück bis zur Hauptstraße sind es 5.3 km.
Einige nachträgliche Einfügungen und Konkretisierungen der deutschen Namen verdanke ich der Deutschen Wikipedia!
Tauchangebote gibt es nicht, es würde sich auch nicht lohnen.
Das Schnorcheln ist am Strand von Sabang und den Felsen nicht
lohnenswert. Auch in der zur
Tagestour (Korallenschnorcheln!) angepriesenen Ulugan Bucht scheint sich das
Schnorcheln nicht mehr zu lohnen (aus 2. Hand).
Seit 2008 wurde allerdings im Nationalpark das Schnorcheln freigegeben.
Die "Schnorchelgebühr" beträgt 50, hinzu kommt das stundenweise
Mieten eines Bootes oder man läuft bis zu dem kleinen Felskap zwischen der
sabangnahen Rangerstation und dem mittleren Strand. Hier gibt es einen schönen
(Ausrufezeichen) Korallengarten, der sich etwa bis 80 m vor der Küste erstreckt
und dann in der Tiefe (wir waren bei Flut dort) verliert. Deutlich sind einige
Spuren früherer Schädigungen erkennbar. Auf einer Fläche von einigen Tausend
Quadratmetern haben sich allerdings auf den freien Stellen schon viele kleine Hart(Stein-)korallen
angesiedelt. Es herrschen Tischkorallen (Acropora spicifera oder palmata)
vor, hier und da gibt es Krusten-, entlang einiger Tidekanäle haben sich als
Strömungsspezialisten Geweihkorallen (Acropora
cervicornis) angesiedelt. Bei diesen Verhältnissen findet man Poritis
sp. (in verschiedenen Wuchsformen vorkommend Berg-, auch Porenkoralle
genannt) und Montipora sp. daher nur selten. Auch Weichkorallen,
diverse Nackt- und Gehäuseschnecken sowie mehrere Fischarten - in beschränkter
Größenordnung - sind zu beobachten. Einige außergewöhnliche Riesenmuscheln (manchmal
dummerweise als Riesenmördermuscheln [Giant Claim] bezeichnet) mit
grünem fein strukturiertem Saum wecken sicherlich auch das Interesse von
Unterwasserverwöhnten. Es gibt keine übermäßigen Anzeichen
für anhaltende anthropogene Schädigung. Lediglich im Küstenbereich findet man
viel an bäumchenartigem Turbinweed
154,
an den Rändern des Korallengebietes ganze Wälder von Sargassum 153.
Am sehr
frühen Morgen oder sehr späten Nachmittag (beides besser Tags zuvor vereinbaren)
lohnt sich die Fahrt auf der Grenze zum Nationalpark, vor allem wegen der
Vogelwelt. Von den Touristen auch schlicht Sabang Fluss genannt, ist er von einem
Mangrovengürtel
142
mit imposanten alten Bäumen gesäumt. Rund 70 Arten verschiedener Bäume, Sträucher,
Palmen und Farne aus 20 Familien bilden die eigentliche Mangrove. Die meisten,
wie die vor Ort dominierende Rhizophora, sind duch Viviparie
gekennzeichnet. An ihren Ästen hängen dicke braune, kugelförmige Früchte, aus denen 50 cm lange, speerförmige Keimlinge
(die grüne "Wurzel" ist das Hypokotyl des Keimlings) sprießen. Fällt er in Salzwasser, so schwimmt er horizontal,
erreicht er aber Brackwasser, so dreht er sich mit den Wurzeln nach unten und
bohrt sich in den weichen Schlamm und hat sich nach einem Jahr verankert. Alle
Früchte oder Samen der anderen Arten sind ebenfalls schwimmfähig.
Im Gezeitenwald gäbe es männliche und weibliche Pflanzen, die
getrennt ohne gegenseitige Befruchtung unterschiedlich aussehende Setzlinge
liefern, erklärt meine Führerin und ich kann es kaum glauben. Allerdings fehlt
mir bisher eine Möglichkeit dies nachzuschlagen. Das Wurzelwerk ist wichtig um
der Küstenerosion entgegen zu wirken und zudem ein bisher vollkommen
unterschätzter ökologischer Faktor z.B. als Kinderstube für vielfältiges
Leben über und unter Wasser. Bisher wurden riesige Flächen gedankenlos
gerodet, vor allem um kurzfristig profitable Shrimpfarmen zu errichten. Nach der
Ausbeutung bleiben karge Wüstenlandschaften zurück auf denen auf Jahrzehnte
hinaus sich kein stabiles Ökosystem mehr ansiedeln kann. Oft wird es dann auch
noch von Landlosen (Squatter, Besetzer) besiedelt. Zudem werden viele Mangrovengebiete abgeholzt um
Holzkohle zu gewinnen.
 Am Ende des gut einen Kilometer schiffbaren Flusses steigen wir aus dem Boot und klettern durch das Stelzenwurzellabyrinth.
Aida (sprich: Eida) Muyano ist auf der Suche nach einem morschen, abgebrochenen
Mangrovenast, den sie auch alsbald findet.
Als sie ihn aufbricht ist zentral eine markröhrenartige Öffnung erkennbar, die nicht ursprünglich zu sein scheint. Durch Schütteln und Schlagen erscheint
daraus nach und nach
ein gut 30 cm langer, schleimiger, fast durchsichtiger Holzwurm (Teredo navalis,
Tagalog tamilok, mangrove woodworm / ship borer). Er hat nach dem Marinieren
oder Kochen eine ähnliche Konsistenz wie Calamares, ist allerdings viel zarter und wird als Delikatesse aber auch
lebend verzehrt, wie Aida demonstriert. Ich lehne es dankend ab und begnüge
mich mit der toten Version.
Am Ende des gut einen Kilometer schiffbaren Flusses steigen wir aus dem Boot und klettern durch das Stelzenwurzellabyrinth.
Aida (sprich: Eida) Muyano ist auf der Suche nach einem morschen, abgebrochenen
Mangrovenast, den sie auch alsbald findet.
Als sie ihn aufbricht ist zentral eine markröhrenartige Öffnung erkennbar, die nicht ursprünglich zu sein scheint. Durch Schütteln und Schlagen erscheint
daraus nach und nach
ein gut 30 cm langer, schleimiger, fast durchsichtiger Holzwurm (Teredo navalis,
Tagalog tamilok, mangrove woodworm / ship borer). Er hat nach dem Marinieren
oder Kochen eine ähnliche Konsistenz wie Calamares, ist allerdings viel zarter und wird als Delikatesse aber auch
lebend verzehrt, wie Aida demonstriert. Ich lehne es dankend ab und begnüge
mich mit der toten Version.
Mir reicht es jetzt aber, ich will schnellstens
ins Boot zurück, denn die Mitgliederversammlung des Moskito Verein
Palawan (MVP
e.V.) ist um mich herum seit geraumer Zeit einberufen worden. Während wir
zurückpaddeln sinniere ich vor mich hin. Wieso bin ich eigentlich nicht von
unendlich vielen Mücken umgeben? Jedes mal wenn eine angeflogen kommt bringe ich
sie stande pedes um. Sekunden später ist wieder eine da, der hoffentlich das
gleiche Schicksal widerfährt. Statt alle Mücken nach einer gewissen Zeit
ausgerottet zu haben, tauchen immer wieder neue auf. Was würde nun passieren,
wenn ich nicht morde? Wäre ich dann nach ein paar Stunden in einer Mückenwolke
verschwunden? Da dies nicht der Fall ist, ringe ich um eine Erklärung.
Vermutlich verhalten sich Mücken anders als Fliegen. Sie fliegen nicht da, wo
andere Fliegen fliegen, sondern bevölkern den Raum sozusagen gleichmäßig.
Aber dies verschiebt das Problem eigentlich nur auf die Fliegen. Wieso gibt es
nicht einen unendlich dichten Fliegenschwarm? Vermutlich ist es zu schawül, ich
schweife ab.
Auf den bogenförmigen Wurzeln, die wie lange, erstarrte Spindelfinger von
Dschungelgreisen aussehen,
und in den Ästen hocken bulldozerähnliche Fische und steigen nun bei Ebbe
herab. Fische, die bei Flut in die Bäume klettern, das muss ich erst mal verkraften! Mit ihren froschähnlichen
Köpfen durchwühlen sie die Schlickschicht nach Nahrungspartikeln und weiden auch Algen unter
Wasser von ihrer Unterlage ab. Da sie mit ihrem gekrümmten
Schwanz sich schnellend vom Boden abstoßen können, erhielten sie den Namen Schlammspringer (Periophtalmus
chrysospilus, Mudskipper). Ihre amphibische Lebensweise wird durch einen
Meerwasservorrat im vergrößerten Kieferraum ermöglicht. Durch Luftschnappen
können sie dessen Sauerstoffgehalt in Grenzen immer wieder auffrischen.
Weitere
Bewohner des Blätterwerks ist die endemische Unterart der gelb und oliv bis tiefschwarz gestreiften,
bis 2.5 m langen Mangroven-Nachtbaumnatter
(Boiga dendrophila multicincta, Tagalog binturan, yellow-striped
Mangrovesnake), juvenile Exemplare der Monitorwarane liegen träge verdauend auf den Ästen, auch Makakentrupps
kreuzen gelegentlich den Fluss über die Brücken
der Dachkronen. Nach kurzweiligen 45 min sind wir wieder zurück an der Station.
Jeder ist herzlich eingeladen vor der Station einen Mangrovenschößling symbolisch für die
Wiederaufforstung zu
pflanzen.
Für die Bankafahrt werden 100 P verlangt, eine Donation für das Pflanzen eines
Mangrovensetzlings ist gerne gesehen. Die manchmal etwas zu enthusiastischen, ehrenamtlichen
Kanuführerin informiert recht gut während der ¾stündigen
Fahrt, aber es leider auch wieder zu viel und zu lange geschnattert. Zum Schluss
geben es dann noch Aida und der Bootsmann ein selbst komponiertes Liedchen zum
Besten.
2005 2008
2008
2011
Ein kleines Problem ist die Überquerung des Poyuy-poyuy - Flusses (Juli 2008): Die Brücke ist weg - seit Monaten kümmert sich niemand trotz der hohen Einnahmen um einen Neubau. U.U. muss man einige Zeit warten, bis jemand greifbar ist, der einen hinüberpaddelt (bei viel Regen ist die Strömung zu stark, kommt noch die Flut hinzu, ist es schlicht zu tief). Es soll in absehbarer Zeit eine Hängebrücke eingerichtet werden. 2011 hatte sich noch immer nichts getan!! Eine Unverschämtheit bei den hohen Eintrittspreisen!
Nachteilig ist, dass viele der folgenden Exkursionen ausschließlich mit unregelmäßigen Beförderungsmitteln sowie mit Führern unternommen werden können. Mopeds oder ähnliches können allerdings nun am Strand geliehen werden, die Anmarschwege zu den Zielen oder Startpunkten sind zu Fuß, mit Ausnahme zum Wasserfall und zur Kirche, leider weit.
Der ca. 1.2 km lange, überwiegend feinsandige gelbliche Strand erstreckt
sich leicht bogenförmig vom Pier bis zu einer ins Meer auslaufenden
Felsformation an der Mündung des Mangrovenflusses. Verständlicherweise sollte
man den ersten Abschnitt am Pier meiden. Vor den größeren Unterkünften wird
der Strand täglich gepflegt, so dass er inzwischen auch
weitestgehend frei von Sandmücken ist. Etwas
anders stellt sich die Situation hinter der Mündung des Flusses dar, hier
können sie saisonweise eine Plage darstellen!!
Der Strand ist besonders kinderfreundlich, da er nur langsam in tieferes Wasser
abfällt und während der Hauptsaison weder Strömung noch übermäßigen
Wellengang aufweist. Dies kann sich allerdings in wenigen Stunden ändern. Also
Vorsicht, denn es sind schon mehrere Badende ertrunken, darunter in erster Linie
Kinder, aber auch angeblich gute Schwimmer!
Die Wassertemperatur lag Anfang Juni 2011 bei 31°C, die Lufttemperatur
schwankte - Niedrigtemperatur bedingt durch einen mehrtägigen Taifunausläufer
- zwischen 25 und 33°C.
Wer auch noch den Sabang Wasserfall sehen will, muss 1.7 km ab Pier vorbei am DAB DAB marschieren. Die
Aufforderung zur "Registrierung"
im Al Puerto Resort kann man geflissentlich übersehen, ist vielleicht aber
sinnvoll wenn man alleine unterwegs ist. Allerdings versucht man sich dort einen
"behördlichen" Anstrich zu geben und will einem noch einen Guide
auf's Auge drücken.
Fast der gesamte
folgende Küstenstreifen besteht aus mehr oder weniger großen Geröllbrocken,
die ein zügiges Vorankommen erschweren und Knöchelverstauchungen provozieren.
Ein wenig besser ist es abschnittsweise am Vegetationssaum, wo sich ein mehr
oder weniger guter Trampelpfad gebildet hat. Auch geht es an einer Stelle einen
Pfad parallel zu der Wasserleitung entlang.
Ab dem letzten Resort sollte man mit ½ h, ab dem Pier mit ca. 40-45 min rechnen. Der Wasserfall entpuppt
sich in der Trockenzeit als Rinnsaal, vor dem terrassenartig drei kleine Becken
gestaut ![]() sind, in die man sich höchstens hineinsetzen kann. Wer keine Lust auf
Laufen hat wird nichts verpassen. Schöner ist es neben dem Wasserfall
hochzuklettern, allerdings gibt es sehr gefährliche, ausgesetzte Passagen! Wer keine
Klettererfahrung hat sollte davon Abstand nehmen. Von oben hat man einen
schönen Ausblick, der breite Bach, vom Mt. Bloomfield kommend, fließt durch dichte
Dschungelvegetation. Vielleicht wäre hier eine längere Tour möglich. In der
Regenzeit stellt sich die Situation anders dar! Dann ist der Fall sehr imposant.
sind, in die man sich höchstens hineinsetzen kann. Wer keine Lust auf
Laufen hat wird nichts verpassen. Schöner ist es neben dem Wasserfall
hochzuklettern, allerdings gibt es sehr gefährliche, ausgesetzte Passagen! Wer keine
Klettererfahrung hat sollte davon Abstand nehmen. Von oben hat man einen
schönen Ausblick, der breite Bach, vom Mt. Bloomfield kommend, fließt durch dichte
Dschungelvegetation. Vielleicht wäre hier eine längere Tour möglich. In der
Regenzeit stellt sich die Situation anders dar! Dann ist der Fall sehr imposant.
Etwa 400 m landeinwärts vom Pier von Sabang taucht in einer 90°-Kurve der Eingang zum Green Forest Paradise Resort auf. Von hier sind es ca. 20 min einen Hügel hinauf. Es geht vorbei am Anzweig zum Resort, die letzten Meter sind recht steil. Oben befindet sich das kleine Rondell einer Open-Air-Kirche und ein Cellphone-Umsetzer und eine Satellitenschüssel. Welch sinnige Kombination: Der direkt Draht zum Himmel. Ein vollständiger Blick über die Bucht von Sabang ist zwar durch die Vegetation auf einige wenige schmale Durchblicke eingeschränkt, aber lohnenswert. Auch ein fotogener Blick auf den Mt. St. Paul eröffnet sich.
Einmalig ist der nächtliche Sternenhimmel, insbesondere bei Neumond, den man natürlich überall in Sabang und Umgebung sehen kann; natürlich am besten abseits jeglicher Lichter. Die nächste stärke Quelle einer Lichtverschmutzung ist Luftlinie etwa 60 km entfernt und damit schon deutlich unter dem Horizont, zudem von den Bergen abgeschirmt. Eine derartig kontrastierte Milchstraße habe ich höchstens noch in der Wüste oder ähnlich abgeschiedenen Orten erlebt. In Europa gibt es dies nicht mehr, auch nicht in Südfrankreich oder den Ägäischen Inseln. Alle gut 2500 Sterne der Südhalbkugel, inklusive "Kreuz des Südens" sind sichtbar. Wer hier nicht mindestens eine Sternschnuppe sieht, dem gebe ich von den nächsten zehn eine ab!
Natürlich bieten sich überall Führer an, der bei dieser Wanderung erforderlich ist (keine Ausschilderung, Wegbeschreibung nicht möglich). Gut bedient ist man bei André und Rosalie im Paraiso.
Als ausgefallenen Führer hat sich Vincent Morilljo (Jg. 1950) gezeigt. Er war einer der ersten Ranger und maßgeblich am Bau des ersten Monkey Trail beteiligt. Er wurde aber auf Grund seiner teilweise sehr rigiden Vorgehensweise gegen illegale Aktionen im Naturschutzgebiet aus dem aktiven Dienst entlassen: So hat er auch schon mal mit Schleuder, Pfeil und Bogen auf die Hinterteile von illegalen Baumfällern geschossen. Eigentlich schade, denn genau diese Leute braucht der Park und der Naturschutzgedanke, der ansonsten oft nur ein Alibi ist. (Allerdings hat er sich noch einiges mehr geleistet.) Darum muss Vincent sich nun mit Putzarbeiten im Office, Toilettenreinigung am Pier und Müllbeseitigung über Wasser halten. Gelegentliche Dschungelführungen sind da ein prima Zubrot. Man findet ihn in seinem Haus schräg gegenüber vom Paraiso / Bambua.
 Frühmorgens
(2005) treffe ich mich mit ihm, er
hat Badelatschen an, Pfeil und Bogen über dem Rücken und hält sich immer noch
für einen Ranger. Au weia, das kann ja heiter werden, denke ich, der hat ja
eine Mattscheibe.
Wir haben uns vorgenommen dem Daylight Hole einen Besuch abzustatten.
Dazu fahren wir am besten auf der (damaligen) Holperstrecke mit dem Tura-Tura - an einen Kampfruf japanischer Kamikazepiloten
erinnernd und vielleicht wird von den Fahrgästen auch ein entsprechender Mut
erwartet -, dem
hiesigen Dschungeltaxi, zu der Streusiedlung Manturon. Ähnelt die Zugmaschine von
Kaling auch
mehr einem rollenden Rasenmäher und erreicht an Steigungen eine Geschwindigkeit
die locker zum Blümchenpflücken ausreicht, so ist sie doch das stabilste und
zuverlässigste Vehikel im ganzen Umkreis. Selbst in der Regenzeit, wenn
andere passen müssen, tuckert es noch über die Piste. Trotzdem ist es immer gut
wenn, wie in diesem Falle, Kaling auch gleichzeitig der Mechaniker ist.
Frühmorgens
(2005) treffe ich mich mit ihm, er
hat Badelatschen an, Pfeil und Bogen über dem Rücken und hält sich immer noch
für einen Ranger. Au weia, das kann ja heiter werden, denke ich, der hat ja
eine Mattscheibe.
Wir haben uns vorgenommen dem Daylight Hole einen Besuch abzustatten.
Dazu fahren wir am besten auf der (damaligen) Holperstrecke mit dem Tura-Tura - an einen Kampfruf japanischer Kamikazepiloten
erinnernd und vielleicht wird von den Fahrgästen auch ein entsprechender Mut
erwartet -, dem
hiesigen Dschungeltaxi, zu der Streusiedlung Manturon. Ähnelt die Zugmaschine von
Kaling auch
mehr einem rollenden Rasenmäher und erreicht an Steigungen eine Geschwindigkeit
die locker zum Blümchenpflücken ausreicht, so ist sie doch das stabilste und
zuverlässigste Vehikel im ganzen Umkreis. Selbst in der Regenzeit, wenn
andere passen müssen, tuckert es noch über die Piste. Trotzdem ist es immer gut
wenn, wie in diesem Falle, Kaling auch gleichzeitig der Mechaniker ist.
Neuerdings (2007) hat er Konkurrenz bekommen: Ein dreirädriger LKW mit Pritsche hört
auf den Namen Tuk-Tuk. 2008 wurde der Betrieb dann leider eingestellt, nun sind
Multicabs unterwegs, sogar die ersten Tricycle gesichtet. Die neuen
Betonabschnitte machen es möglich. Seit 2011 ist diese ganze
"Romantik" hin, die Straße ist fertig.
In der Rangerstation müssen wir uns
zum Betreten des Nationalparks anmelden, dazu sind 30 Pesos fällig. Hier gibt es
auch ein kleines ethnografisches Museum, das ein wenig aus dem häuslichen Leben der
nativen Tagbanuwa erzählt.
Schon wenige Meter nach unserem Aufbruch bleibt Vincent stehen und deutet auf
die schreckhafte, aber unangenehme borstenartige Stacheln tragende Mimosen (Sinnpflanze, Mimosa pudica) am Wegrand. Ihre
fast einzigartige Fähigkeit auf Berührungsreize die Blätter zusammen zu
klappen und die Blattstiele zu senken, beruht auf eine rasche Änderung des
Tugordruckes, die durch eine hormonartige Substanz ausgelöst wird. Die
Reaktionszeit beträgt im besten Falle 8/100stel Sekunden und läuft mit einer
Geschwindigkeit bis zu 10 cm pro Sekunde ab. 10 bis 20 Minuten nach dem Reiz
werden die Bewegungen wieder rückgängig gemacht. Die Batak gewinnen aus den Wurzeln ein Mittel
gegen Malaria und Hämorrhoiden, erklärt er. Malaria und Hämorrhoiden, denke
ich, ein weites Anwendungsspektrum. Vielleicht auch noch gegen Fußpilz, fällt
mir lästernd ein. Und weiter geht es durch die Waldapotheke. Die Blätter eines
Strauches sind gut gegen Hauterkrankungen, andere bekämpfen die Würmer im
Verdauungstrakt von Schweinen, die nächste Blume ist gut bei Entzündungen der
Augen. Aus
den Rattanlianen werden Möbel hergestellt, der Pterocarpus indicus
(Tagalog Narra) liefert eisenhartes, termitenresistentes Holz und ist
der philippinische Nationalbaum. Aus ihm wird ein natürlicher roter Farbstoff
hergestellt, darüber hinaus enthält der Baum einige Substanzen, die als
Grundlage für Medikamente dienen. Es gibt hier zwei Unterarten: P. indicus
indicus und P. indicus echinatus.
Schließlich kramt er noch einen Brocken aus seiner Tasche, den ich zunächst
für Bernstein halte. Und ein Harz ist das baktik (Tagalog) auch, aber kein
fossiliertes. Die Einheimischen gewinnen es aus dem Almasiga-Baum
(Tagalog) und verwenden es als Brandbeschleuniger, die Westler (Handelsname MANILA COPAL)
rühren daraus den wohl teuersten Klarlack der Welt an, u.a. für die Klavier-
und Geigenbearbeitung der Rolls Royce - Klasse. So kommt es, dass auch hier am
Wochenende, weil dann die Behörden dicht haben, verbotener-, aber säckeweise
sich die Harzklumpen am Pier stapeln. Verboten heißt: wenn es aus dem
Nationalpark stammt und dafür gibt es leider keinen Nach-, respektive Beweis.
Etwas außergewöhnlich
ist das fliegende Eichhörnchen (Hylopetes nigripes, Flying Squirrel), das zwischen den
verlängerten Rippenknochen eine Flughaut aufspannen und so kurze Strecken von Baum zu
Baum segeln kann; von fliegen also keine Rede. Eine ähnliche Entwicklung (konvergente Evolution)
hat
der Flugdrachen (Draco spp.) durchlaufen, eine Art fliegender Gecko.
Eigentlich ist fliegen zu viel gesagt, es handelt sich nicht um ein aktives
Fliegen, vielmehr ist es ein gleiten. Vincent beeindruckt durch seine Kenntnis
einiger lateinischer Namen ... und ist plötzlich sauer. Den Steg hat er erst
vor kurzem gebaut und jemand hat daraus eine Holzlatte geklaut. Oh je, hoffentlich
bekommt er jetzt nicht die ganz schlechte Laune. (2008 war die Brücke weg. Es
sollte jeder, den es betrifft, mal bei den Rangern am Pier die Neueinrichtung
reklamieren!)
Wir folgen auf der anderen
Seite eine Weile dem Fluss, der
plötzlich in einer Öffnung der Karstwand verschwindet. Der Untergrundfluss beginnt hier an zwei
Einlässen seine 8.2 km lange dunkle Reise. Im Sand des Flussbettes steckt ein
primitiver Speer mit einer eindrucksvoll scharfen Holzspitze. Natives, sagt
Vincent in seinem recht guten Englisch und blickt sich um. Zweifelnd schaue ich
ihn an. Will er hier etwa einen Krieg führen und ich stehe dann zwischen den
Fronten? Aber zunächst geht es weiter.
 Wir sind nun eine halbe Stunde unterwegs, als mein Wegweiser und Buschlexikon mir plötzlich
andeutet stehen zu bleiben. Pfeil und Bogen werden schussbereit gehalten,
geduckt pirscht er auf eine Rauchsäule mitten im Unterholz zu. Nach wenigen
Minuten gibt es Entwarnung, ich atme auf, kein verletztes Hinterteil ist zu
desinfizieren, die Einheimischen haben sich schon längst aus dem Staub gemacht.
Vincent steht vor einem noch glühenden Lagerfeuer und löscht es grimmig mit
Erde. Feuermachen im Nationalpark ist strengstens verboten, sagt er und
vermutlich wollten die auch illegal auf Schwalbennestersuche gehen. Natives, frage ich, doch er
schüttelt den Kopf und meint: Christen!
Wir sind nun eine halbe Stunde unterwegs, als mein Wegweiser und Buschlexikon mir plötzlich
andeutet stehen zu bleiben. Pfeil und Bogen werden schussbereit gehalten,
geduckt pirscht er auf eine Rauchsäule mitten im Unterholz zu. Nach wenigen
Minuten gibt es Entwarnung, ich atme auf, kein verletztes Hinterteil ist zu
desinfizieren, die Einheimischen haben sich schon längst aus dem Staub gemacht.
Vincent steht vor einem noch glühenden Lagerfeuer und löscht es grimmig mit
Erde. Feuermachen im Nationalpark ist strengstens verboten, sagt er und
vermutlich wollten die auch illegal auf Schwalbennestersuche gehen. Natives, frage ich, doch er
schüttelt den Kopf und meint: Christen!
Wir legen eine kurze
Pause ein, denn anschließend geht es in einem schweißtreibenden Aufstieg steil
bergan, an einigen Stellen muss auch ein wenig geklettert werden. Gut dass ich
meine festen Sportschuhe mitgenommen habe, wie Vincent das mit seinen
Badelatschen macht ist mir ein Rätsel. Immerhin ist das scharfkantige
Kalkgestein sehr griffig, wenn auch Moose und Flechten immer wieder für
rutschige Tritte sorgen. Im eigenen Saft gebadet erreiche ich schließlich
einen Felsvorsprung auf dem er schon seit längerem kauernd auf mich wartet
und urplötzlich stehe ich vor dem Daylight Hole.

Von wegen Loch. Eine riesige halbovale Grotte, etwa 100 m ü.N.N., hat sich aufgetan, sicherlich an
die 60 Meter hoch, gut und gerne 100 m breit und verliert sich in einer Höhle. Mein erster, zweiter und dritter Eindruck:
beeindruckend! Leichte Nebelschwaden ziehen aus dem Schlund und tauchen die bis
in den letzten vom Licht erreichten Winkel, mit niedrigen Pflanzen begrünte Szenerie, in eine
unwirkliche Atmosphäre die mich an eine vergessene Welt erinnert. Ich
komme mir vor wie in der idealen Kulisse für einen Streifzug in die Dinosaurierzeit und
erwarte die Auferstehung von Kingkong und Godzilla. Würde jetzt ein
Archäopterix vorbeisegeln wäre ich nicht erstaunt.
Nach kurzer Pause steigen wir in die eleusinisch wirkende Höhle hinab. Kein
Geräusch ist zu hören, nur selten jagt eine Schwalbe vorbei. Was sich aus der Ferne
wie Geröllschutt präsentierte, sind in Wirklichkeit haushohe Brocken. Tief im
Inneren stoßen wir auf kleine, offensichtlich hohle Felsenformationen, die beim Anschlagen wie ein Gong
klingen. Es drängt sich die Vermutung auf, dass es sich um Stalagmiten
handelt.
 Es
wird immer düsterer, die Öffnung ist bald nur noch ein heller Fleck
im Hintergrund. Langsam adaptieren die Augen, aber nicht
schnell genug. Vincent bedeutet stehen zu bleiben, nimmt einen größeren Stein und wirft
ihn vor uns auf den schwarzen Boden. Das heißt, erst einmal höre ich gar nichts, fünf Sekunden
später gibt es dann einen Klack. Vorsichtig soll ich von jetzt an sein, ich nicke
etwas verkrampft, habe schnell verstanden und stelle mir vor, ich wäre hier alleine
hinein gegangen. Vermutlich läge ich nun 50 m tiefer und etwas weniger lebendig.
Wie ein stellares schwarzes Loch verschluckt auch dieses jegliches Licht, im
Unterschied kann man es, allerdings nur mit einem Seil, betreten und wieder
verlassen. Es verbindet die Höhle mit dem Untergrundflusses kurz nach dessen
Einflussöffnung, die durch Geröll und Baumstämme für Menschen nicht durchlässig
ist.
Es
wird immer düsterer, die Öffnung ist bald nur noch ein heller Fleck
im Hintergrund. Langsam adaptieren die Augen, aber nicht
schnell genug. Vincent bedeutet stehen zu bleiben, nimmt einen größeren Stein und wirft
ihn vor uns auf den schwarzen Boden. Das heißt, erst einmal höre ich gar nichts, fünf Sekunden
später gibt es dann einen Klack. Vorsichtig soll ich von jetzt an sein, ich nicke
etwas verkrampft, habe schnell verstanden und stelle mir vor, ich wäre hier alleine
hinein gegangen. Vermutlich läge ich nun 50 m tiefer und etwas weniger lebendig.
Wie ein stellares schwarzes Loch verschluckt auch dieses jegliches Licht, im
Unterschied kann man es, allerdings nur mit einem Seil, betreten und wieder
verlassen. Es verbindet die Höhle mit dem Untergrundflusses kurz nach dessen
Einflussöffnung, die durch Geröll und Baumstämme für Menschen nicht durchlässig
ist.
Wir tasten uns nur noch einige Meter um den riesigen Schacht herum, dann ist Schluss, ohne Lampe geht
nun wirklich nichts mehr. Während wir eine stille Ruhepause einlegen lasse ich die Umgebung auf
mich einwirken. Ein fantasievolles Bild liegt vor mir wie es kein
surrealistisch angehauchter Fantasykünstler auch nur annähernd entwerfen könnte, zudem angenehm
kühl. Kein Wunder, dass Nebelschwaden beim Vermischen mit der feuchttropischen
Außenluft entstehen. Ich kann mich nicht losreißen und bleibe länger als
geplant, aber schließlich müssen
wir zurückkehren und lassen eine wunderbare, eigenartige Welt für sich alleine
zurück. Hier ist sie doch noch: "Die letzte Grenze".

Bei Tagabinet weist ein Schild zu einem isolierten Felsen. In dessen Höhlen
klingen einige Stalaktiten beim Anschlagen wie ein Gong - daher der Name. Er und
seine Kollegen im Umfeld erinnern stark die Landschaft der "trockenen
Halong Bay bei Ninh Binh /
Vietnam und Teilen des Kao Sok
Nationalparks in Thailand. Alle haben
eine sehr ähnliche geologische Entstehungsgeschichte. Die einzeln stehenden, dicht bewachsenen
Kalksteinfelsen mit ihren
kahlen Steilwänden sind vor etlichen Millionen Jahren ehemaliger, punktuell
gehobener Meeresboden und eine optische Augenweide.
Zudem bietet er einen prima Aussichtspunkt. Im ganzen Gebiet wurde in früheren Jahren
Marmor gebrochen, eine in tieferen
Erdschichten metaphorisierte Form des Kalksteins CaCO3, die Ausbeute lohnt
aber heute nicht mehr.
Von Sabang aus dauert die Fahrt eine knappe Stunde. Dort weist ein Schild den
Abzweig, dann muss man direkt vor der Schule den kleinen Pfad nehmen. Zunächst
folgt man einem hohen Spalt, den vor Äonen einen Wasserlauf ausgewaschen hat.
Schon hier und auch später sollte jeder ein Taschenlampe, am besten eine
Stirnlampe dabei haben. Auf der anderen Seite biegt man nach links den Pfad ab,
bis man eine längere Holztreppe erreicht. Sie führt zu einer kleinen Höhle,
in der mehrere schöne, teils erodierte Tropfsteine zu sehen sind. Am Ende der
Höhle leitet ein Doppelseil mit Knoten den weiteren Weg nach oben. Von dort
muss man ein wenig klettern, um zur nächsten Treppe zu kommen. Der weitere
Verlauf ist ein wenig trickreich. Zunächst zwängt man sich durch das schmale
Felsfenster oberhalb, hält dann auf das entferntere Lichtfenster zu, biegt
jedoch auf halben Weg nach links in eine Felsspalte ein. Sie endet unterhalb der
letzten beiden Treppen, dann ist die große Unterstellhütte mit rotem Dach,
dass man schon von der Durchgangsstraße erblicken kann, erreicht. Aus Belohnung
winkt ein schöner Ausblick über die Umgebung. Trinkwasser sollte nicht
vergessen werden! Eintritt wird noch nicht erhoben, wäre aber bei der dort
geleisteten Arbeit (das ganze Material hochschleppen und in Stand halten)
durchaus angemessen.
 Folgt man der zweispurigen Piste vorbei an der Schule bis
zum Ende in ca. 1.5 km, so erreicht man den Babuyan Fluss, der die Grenze zum
Nationalpark bildet. Hier wurde 2005 kräftig illegal eingeschlagen, Brandrodung
betrieben und mit Holzflößen säckeweise baktik und
Edelholz herangeschifft. (Die Stelle direkt am Fluss, siehe Bild, war 2008 nicht
mehr wieder zu finden, so rasch hat sich die Vegetation wieder erholt. Andere,
weiter entfernte, werden weiterhin als Anbaufläche genutzt.) Der Bürgermeister von PPC hat sich nach diesem Hinweis
umgehend mit dem dortigen Polizeichef in Verbindung gesetzt und ihm die Weisung
gegeben, die dafür Verantwortlichen ausfindig zu machen und sofort einzulochen.
Nur wenige Tage später erhielt ich dann über einen Mittelmann eine Warnung der
kommunistisch orientierten NPA (New People's Army), mich nicht mehr in Sabang und
Umgebung blicken zu lassen, das würde meiner Gesundheit schaden. Na bravo. Noch
ein paar Tage später wurde mir sogar eine ganz unglaubliche Geschichte zu
dieser Version gesteckt. Davon erzähle ich aber besser nur privat.
Folgt man der zweispurigen Piste vorbei an der Schule bis
zum Ende in ca. 1.5 km, so erreicht man den Babuyan Fluss, der die Grenze zum
Nationalpark bildet. Hier wurde 2005 kräftig illegal eingeschlagen, Brandrodung
betrieben und mit Holzflößen säckeweise baktik und
Edelholz herangeschifft. (Die Stelle direkt am Fluss, siehe Bild, war 2008 nicht
mehr wieder zu finden, so rasch hat sich die Vegetation wieder erholt. Andere,
weiter entfernte, werden weiterhin als Anbaufläche genutzt.) Der Bürgermeister von PPC hat sich nach diesem Hinweis
umgehend mit dem dortigen Polizeichef in Verbindung gesetzt und ihm die Weisung
gegeben, die dafür Verantwortlichen ausfindig zu machen und sofort einzulochen.
Nur wenige Tage später erhielt ich dann über einen Mittelmann eine Warnung der
kommunistisch orientierten NPA (New People's Army), mich nicht mehr in Sabang und
Umgebung blicken zu lassen, das würde meiner Gesundheit schaden. Na bravo. Noch
ein paar Tage später wurde mir sogar eine ganz unglaubliche Geschichte zu
dieser Version gesteckt. Davon erzähle ich aber besser nur privat.
Auf dem Fluss soll sich eine 6-8stündige Kanufahrt auf dem Babuyan Fluss bis in die Honda-Bay lohnen! Boote könne man über den Yachtclub im IBMC Marina in PPC organisieren, die wiederum einen Amerikaner gut kennen, der diese Fahrt ggf. organisiert.
Für Hardcoretrekker gibt es noch die Möglichkeit eine Dreitagestour quer durch die Insel zu unternehmen - DER ultimative Kick in den 1980iger Jahren und noch heute. Eine gute Kondition, Ausrüstung und die Fähigkeit mit einfachen Verhältnissen leben zu können ist unabdingbar. Als Führer eignet sich z.B. Ronnie Manga, Vincent würde unterwegs sicher nur Krieg führen.
Ein empfehlenswertes Bestimmungsbuch für Pflanzen auf Palawan (englisch) findet sich in der Literaturliste.
* Narra-Baum: Pterocarpus
indicus, Amboina, Roter Sandelholzbaum; es gibt hier zwei Unterarten: P.
indicus indicus und P. indicus echinatus. Er ist der Nationalbaum der
Philippinen, stammt vorwiegend aus Ozeanien und Südostasien (Burma, Vietnam,
Indonesien, Malaysia, Papua Neu Guinea, Thailand, Philippinen, Solomon Inseln)
und ist eines der schönsten und interessantesten Edelhölzer der Welt. Bereits
vor über 100 Jahren in Europa eingeführt, wird es nach der Molukken-Insel
Ambon meist Amboina genannt, kommt aber auch unter den Handelsnamen Amboyna,
Narra, Nara, Narravitail, Angsana, New Guinea rosewood, Papua New Guinea
rosewood, Sena, Solomons padauk, Yaya sa, Kubooka, Dang-houng, Cibi-cibi in den
Handel. Der Name “Rosewood” sollte nicht verwendet werden, da für einen
anderen Baum reserviert. Das wenig exportierte Stammholz heißt Padauk / Padouk.
Zur Familie der Leguminosen (Schmetterlingsblütler) gehörend gibt es ungefähr
60 verschiedene Arten. Der extrem langsam wachsende Amboina wird oft als Zier-
und Schatten spendender Baum gepflanzt und ist beliebt wegen seines schönen
Laubes, das er bei Jahreszeitenwechsel abwirft, und seiner auf Rispen sitzenden,
leuchtend gelben und duftenden Blüten (auf den Philippinen meist Februar bis
Mai, oft schon vor dem Blattaustrieb), die sich nur für einen Tag öffnen. Er
wird bis zu 35 m hoch, der Stammdurchmesser kann 3 m betragen. Die Rinde ist außen
graubraun bis oliv und löst sich bei alten Exemplaren in dünnen Streifen vom
Baum. Innen ist die Rinde hellrot und bei Verletzungen fließt ein roter Saft
aus. Aus ihm wird ein natürlicher roter Farbstoff hergestellt, darüber hinaus
enthält der Baum einige Substanzen, die als Grundlage für Medikamente dienen.
Das Kernholz kann viele Farben annehmen: blutrot, goldbraun, hellgelb, rotbraun
oder kräftig rot; durch Lichteinwirkung dunkelt es nach. Das Splintholz ist
klar vom Kernholz abgesetzt und weißlich oder strohgelb. Die Holzfasern sind
wirr und wellig. Die spezifische Dichte beträgt 0.6-0.7 g/cm³; es ist
weitgehend pilz- und insektenfest, eisenhart, termitenresistent und findet daher
Anwendung im Möbelbau, als hochwertiges Furnier, zu Schnitzereien, für
Musikinstrumente, als Parkett und für Drechselarbeiten. Auch Eisenbahnschwellen
wurden aus Amboina gefertigt, ebenso wurde es im Brückenbau verwendet.
Oft befinden sich kleine Knoten im Holz, die ein ausgesprochen schönes Bild
ergeben, die Oberfläche ist leicht glänzend. Bei der Bearbeitung entwickelt es
einen typischen, wundervoll aromatischen, rosenartigen Duft. Die Trocknung ist
unproblematisch, es verwirft sich kaum und ist formstabil. Angeblich werden die
großen Maserknollen am stehenden Baum geerntet und wachsen nach.
Die große Nachfrage nach Statussymbolen aus Narra-Holz - 1985 exportierten die
Philippinen noch 3000 t – ließ den Narra-Baum aus den philippinischen Wäldern
bis auf Restbestände verschwinden. Deshalb beschloss die philippinische
Regierung 1987, dass das Abholzen, das Sammeln und der Export von Narra grundsätzlich
verboten sind. Die Forstkultivierung zu gewerblichen Zwecken ist davon
ausgenommen. Die hohen erzielbaren Preise locken jedoch weiterhin Holzwilderer
und Exportschmuggler an. Oft wird legaler Holzeinschlag mit illegalem Einschlag
von Narra-Bäumen verbunden. Heute finden sich Restbestände von Narra-Bäumen
insbesondere nur noch an der Küste der Provinz Isabela, den Sierra Madres, in
Bicol, Mindanao und den Wäldern von Cagayan. Daten aus einer landesweiten
Bestandsaufnahme liegen nicht vor und es wurden auch keine größeren Projekte
zur Aufforstung speziell dieses Baumes gemeldet.
Ausführlicher siehe dazu auch unter: http://bethge.freepage.de/narratree.htm
(deutsch).
Der besonders hartholzige Aguho-Baum (Casuarina equisetifolia, auch agoho / aguho, casuarina tree / needle pine) kam früher auf den Philippinen in großer Zahl vor; besonders Camiguin schien er zu bevorzugen (ein dortiger Dorfname zeugt noch davon). Diese Schachtelhalmblättrige Kasuarine (Kängurubaum, Kasuarinabaum) wird zu den 45 Arten (sic!) umfassenden Eisenhölzern gerechnet. Die meisten kommen überwiegend im Inneren von Australien vor. Zu der Vielzahl von Eisenhölzern - eigentlich ein Handelname - gehören auch Baumarten wie Eusideroxylon zwageri, aus dessen Holz in Borneo Blasrohrpfeile gefertigt werden. In Indien wird der Nagasbaum oder Gau-gau (Mesua ferrera) häufig angepflanzt.
** Almasiga (Almaciga) gehört zu den malaiischen Weichhölzern, Gattung Koniferen (Agathis spp.), mit einem spez. Gewicht von 0.465 g/cm³. Das Holz eignet sich gut für Schränke, Regalbretter, Sperrholz, Furniere, für Drechselarbeiten und die Tischlerei.
Webhosting AUCH für den kleinsten
Geldbeutel: ![]()
Waren meine Informationen hilfreich? Die Berichte, Scherze und
Anekdoten gefällig? Dann freue ich mich über eine Weiterempfehlung meiner Seiten und
bitte das © "Nik"Klaus
Polak, Bonn, Germany,
zu unterstützen: Entgegen der weit verbreiteten Auffassung alles im Internet
veröffentlichte Material sei frei nutzbar, besteht ein Ernst zu
nehmendes und rechtlich abgesichertes Copyright!
Wegen schwerer dauerhafter
Erkrankung bitte ich keinerlei Reiseanfragen mehr an mich zu richten. Danke!
Ich verweise auf die
viel besser informierten Länderforen / -boards und Reisehandbücher.
Anfragen zu Verlinkungen u.ä. Anliegen werde ich mit Sicherheit nicht mehr
beantworten!
An die Adresse ![]() können jedoch gerne Aktualisierungen,
Fehlerkorrekturen und konstruktive Anregungen gemailt werden.
können jedoch gerne Aktualisierungen,
Fehlerkorrekturen und konstruktive Anregungen gemailt werden.
Ich werde, je nach Gesundheitszustand, versuchen sie einzupflegen. Bitte
gleichzeitig mitteilen, wer keine Namensnennung wünscht.
Bei Zuschriften bitte folgende Wünsche beachten:
Ich danke für das Verständnis und die Rücksichtnahme.
© "Nik"Klaus Polak, Bonn, Germany
Niks Reiseberichte
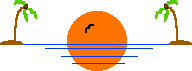
Fasten seatbelt ... und dann niks wie weg!